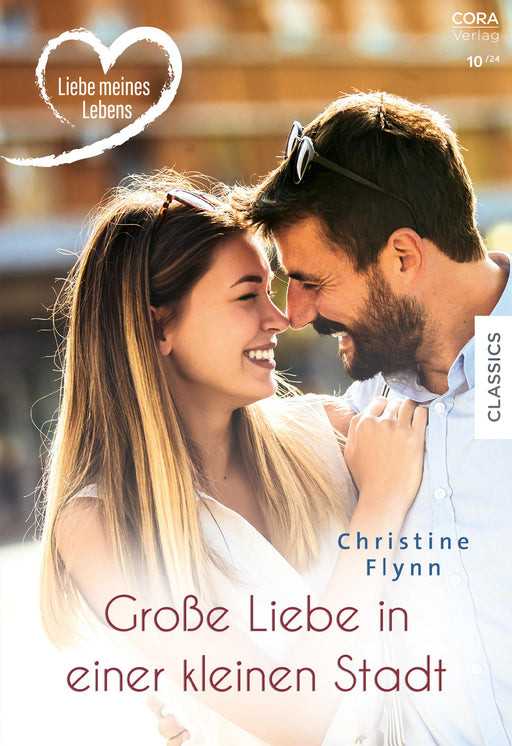Auf verbotenen Wegen
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Lillith schwebt in Lebensgefahr, seit sie einen Mord beobachtete. Nur in den Armen von Deegan Galloway - ein Mann, der in der Unterwelt so zu Hause ist wie auf den Bällen der feinen Gesellschaft - scheint sie sicher. Doch wie lange noch? Können sie gemeinsam dem Täter das Handwerk legen, ehe Lillith sein nächstes Opfer wird?