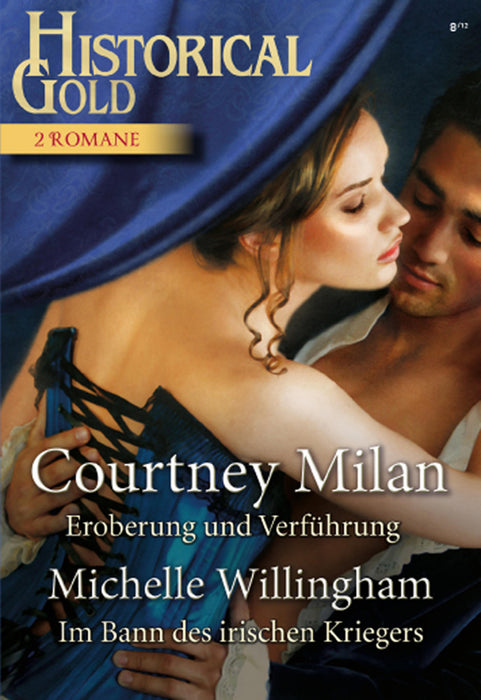
Historical Gold Band 251
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Im Bann des irischen Kriegers von Willingham, Michelle
Bebend löst sich Brenna aus den Armen Quin MacEgans. Der starke irische Krieger weckt Gefühle in ihr, denen sie niemals nachgeben darf! Wenn sie den Pfad der Leidenschaft beschreitet, wird sie womöglich eine Hure wie ihre verhasste Mutter. Nein, Brenna will nur einen Mann heiraten, für den sie kein Verlangen verspürt! Und trotzdem fühlt sie sich in Quins Nähe immer wieder versucht, die Grenze zu überschreiten …
Eroberung und Verführung von Milan, Courtney
Wie sehr verachtet Lady Margaret den künftigen Duke of Parford! Dieser Emporkömmling, der Parford Manor für sich beansprucht, will ihre Familie ruinieren. Verkleidet als Hausmädchen wird sie ihn ausspionieren und sein Vorhaben vereiteln. Doch sein Lächeln bezaubert sie, in seinen Armen schmilzt sie dahin. Bald muss ihr Herz sich entscheiden - für die Familie oder den Mann, der ihr alles nehmen will …













