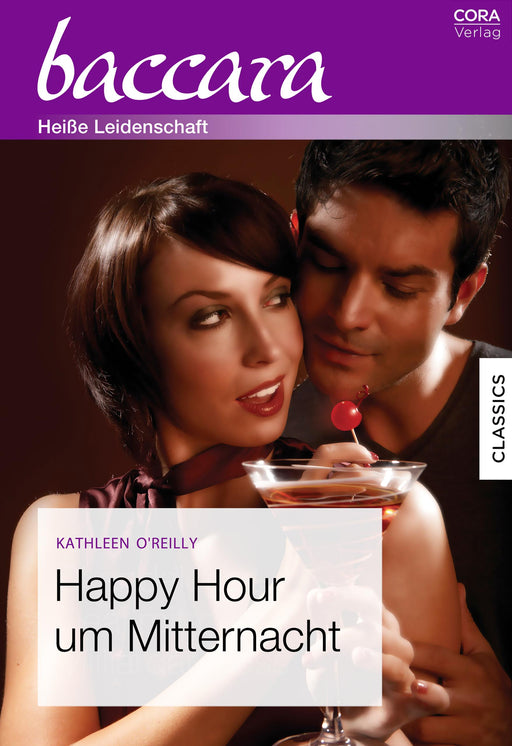Das Schloss der verbotenen Träume
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Dieser selbstgefällige Marquess of Mantaigne will Dayspring Castle für sich beanspruchen und wagt es sogar, ihr einen Kuss zu rauben! Polly Trethayne ist empört. Schließlich war sie es, die das Schloss vor dem Verfall gerettet hat. Doch warum schlägt Pollys Herz in der Nähe des attraktiven Marquess bloß so schrecklich schnell?