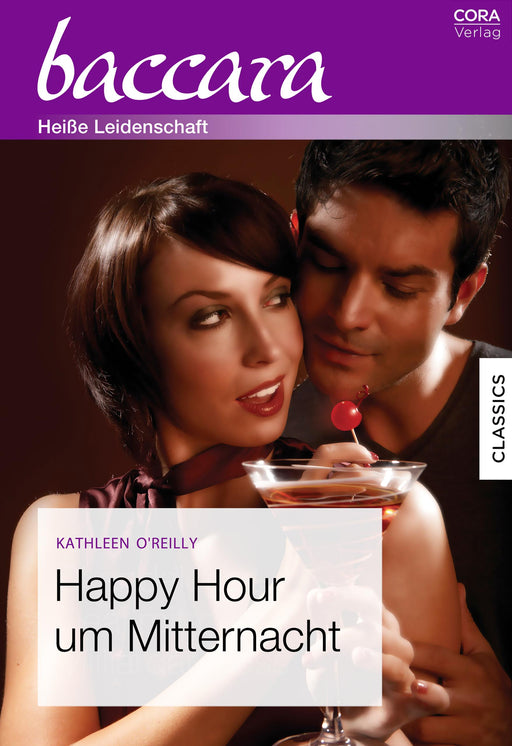Historical Saison Band 66
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
EIN GENTLEMAN UND HERZENSBRECHER von TYNER, LIZ
Er ist nicht nur ein attraktiver, sondern auch ein ehrbarer Mann - davon ist Rebecca überzeugt. Hingebungsvoll pflegt die Pfarrerstochter den Fremden, den sie nach einem Überfall im Wald gefunden hat. Nach seiner Genesung macht Fenton Foxworthy ihr einen Antrag. Sie jubelt Ja - bis ihr gewahr wird, dass er sie getäuscht hat …
SKANDAL UM MISS ISABELLA von BEACON, ELIZABETH
Nie zuvor war Miss Isabella Alstone so sehr versucht, alle Regeln des Anstands zu brechen! Als ein verführerischer Mann sie vor dem Ballsaal in seine Arme zieht, schwinden ihr schier die Sinne. Doch dann erfährt Isabella, wer sie so betört hat: Wulf FitzDevelin. Der verbannte Halbbruder des Mannes, den sie heiraten soll …