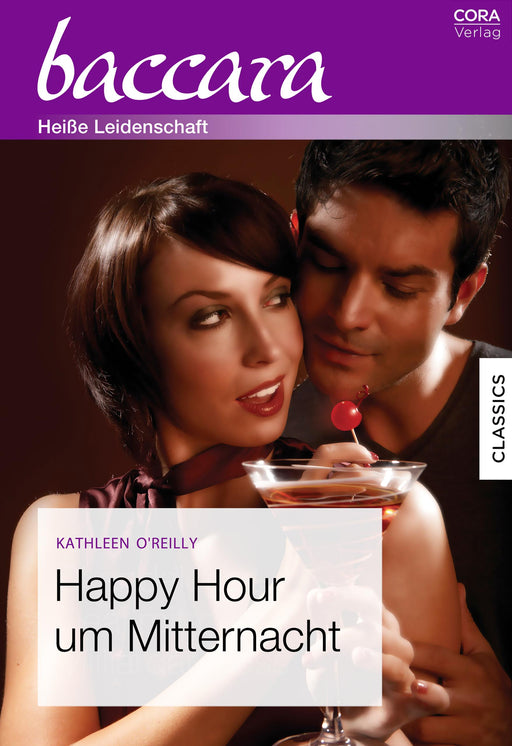Historical Saison Band 79
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
PIKANTES ARRANGEMENT MIT LORD GRAHAM von ELEANOR WEBSTER
Zärtliche Stunden? Die gibt es in Beths Ehe nicht. Nur um nicht bettelarm zu enden, hat sie ihren Jugendfreund Ren geheiratet. Gleich darauf hat er sein altes Leben in London wieder aufgenommen. Doch nun kehrt der Lord zu ihr zurück. Vertraut wie einst - aber ungewohnt verführerisch und mit einem Plan, der ihr den Atem raubt …
MISS SILVERDALE SPIELT GEFÄHRLICH von LARA TEMPLE
Miss Olivia Silverdale ist in geheimer Mission unterwegs: Sie will die Wahrheit über den Tod ihres geliebten Patenonkels herausfinden. Doch dafür muss sie mit Lucas, Earl of Sinclair, zusammenarbeiten. Als der sündige Earl ihr einen Kuss raubt, entwickeln sich Olivas Nachforschungen in eine höchst gefährliche Richtung …