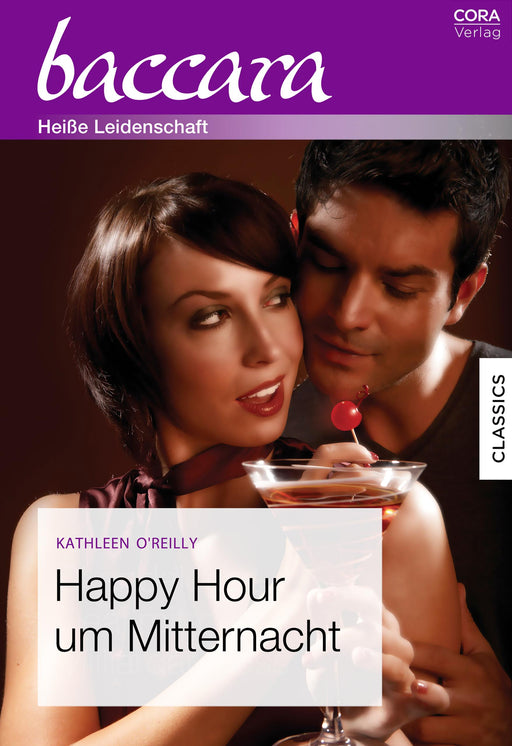Julia Extra Band 506
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
UNSCHULDIG VERFÜHRT AUF CAPRI von JACKIE ASHENDEN
Lucy will nur eins von Vincenzo de Santi: dass er sie vor ihrem kriminellen Vater beschützt! Bis nie gekannte erregende Gefühle in ihr erwachen …
KÜSS MICH, GELIEBTER KÖNIG von MAISEY YATES
Um ihr Erbe nicht zu verlieren, muss Tinley sich von König Alexius einen passenden Ehemann suchen lassen. Dabei schlägt ihr Herz für Alexius selbst …
NUR EINE HEISSE AFFÄRE AUF HAWAII? von CATHY WILLIAMS
Hoteltycoon Max Stowe ist auf Hawaii, um seine verschwundene Schwester suchen – nicht für eine erregende Affäre mit ihrer Freundin Mia! Oder?
DIE LETZTE NACHT MIT PRINZ DANTE von KIM LAWRENCE
Eine letzte Nacht der Lust, danach will Beatrice ihren lieblosen Ehemann Kronprinz Dante verlassen! Noch ahnt sie nichts von den Folgen dieser Nacht …