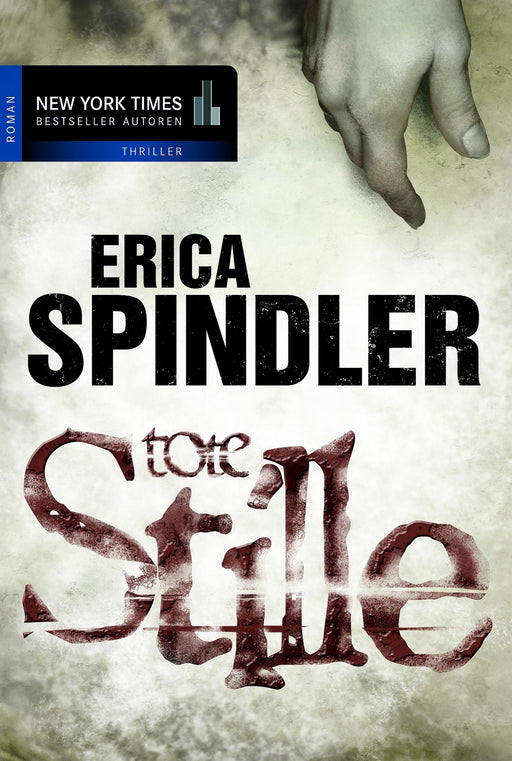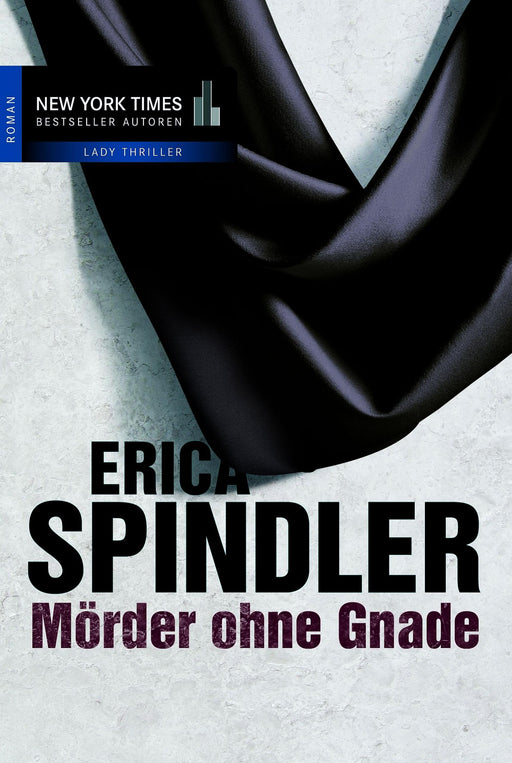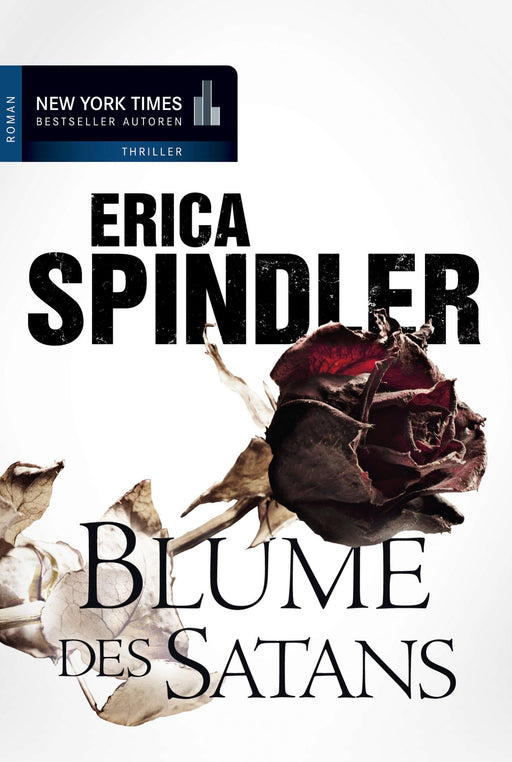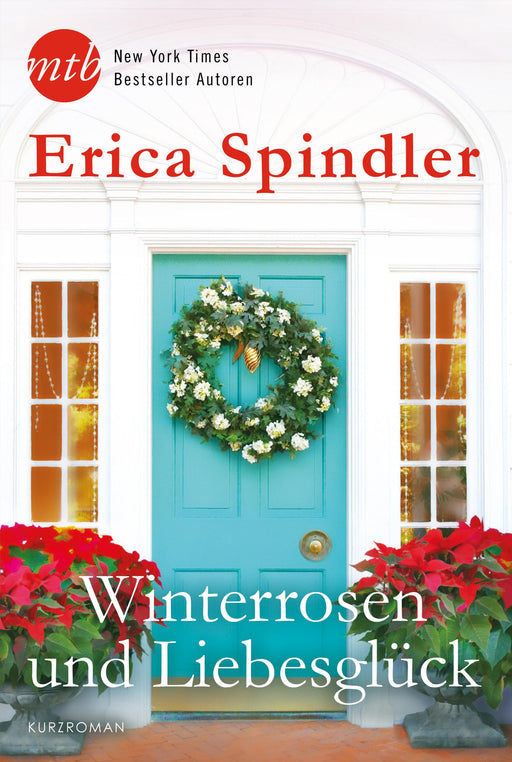Macht des Schicksals
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
M - immer wieder schreibt Skye Dearborn diesen Buchstaben, aus einer dunklen Erinnerung ihres Unterbewusstseins heraus. Wer sie wirklich ist, und warum sie von ihrer eigenen Mutter als Kind aus der Mitte der mächtigen Monarch-Familie gekidnappt wurde, erfährt sie erst, als das Schicksal zuschlägt. Denn getrieben von dem Wunsch, ihre Zukunft allein zu meistern, verlässt sie Chance McCord, den sie liebt, und wird eine erfolgreiche Schmuckdesignerin bei dem Mann, vor dem ihre Mutter sie immer schützen wollte. Jetzt ist er seinem Ziel ganz nah: Skye zu besitzen - oder sie zu töten