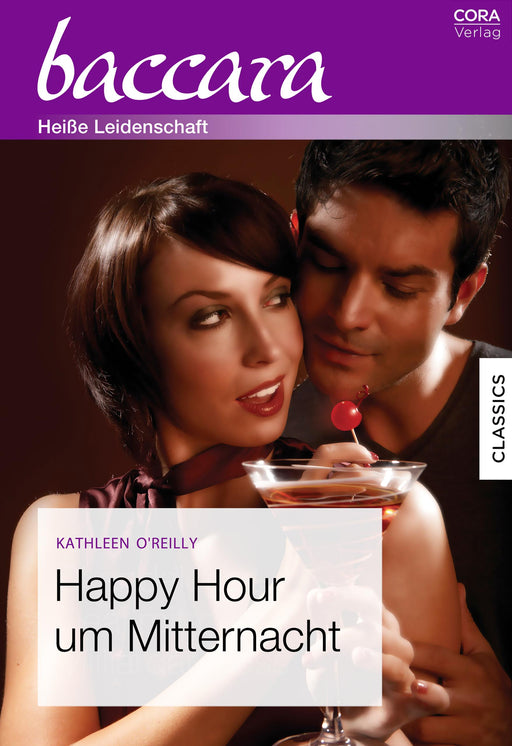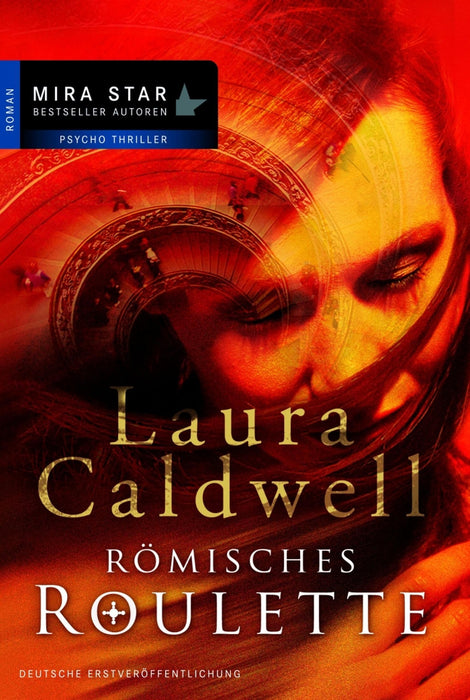
Römisches Roulette
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Rachel und Nick Blakely scheinen ein perfektes Leben zu führen, aber ihre Ehe leidet unter den Folgen einer Affäre, die Nick seiner Frau erst nach langem Zögern gebeichtet hat. Rachel ist verletzt, aber auch wild entschlossen, um ihre Ehe zu kämpfen. Ein Jahr später stolpert sie selbst auf einer Reise mit ihrer besten Freundin Kit unversehens in eine leidenschaftliche Nacht mit einem italienischen Maler. Kit schwört ihr, Stillschweigen zu bewahren - doch Rachel ahnt nicht, welchen Preis sie dafür zahlen muss. Eine Spirale aus Lügen, Angst und Gewalt reißt sie alle in einen Strudel, aus dem es kein Entkommen gibt.