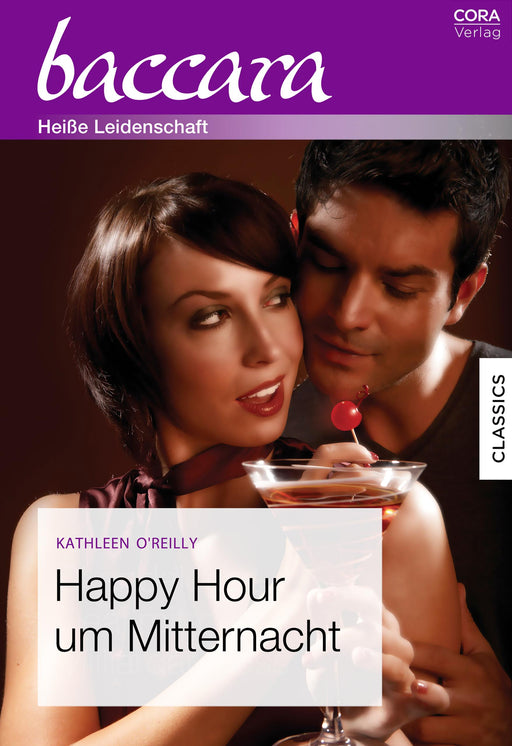Zärtliche Krieger: Ritter und Bastarde - Best of Historical 2020
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Mit diesem eBundle präsentieren wir Ihnen die schönsten und erfolgreichsten Historical-Romane aus 2020 - leidenschaftlich, aufregend und romantisch. Die kleine Auszeit vom Alltag für die selbstbewusste Frau … Happy End garantiert!
DIE SCHÖNE GEFANGENE DES WALISISCHEN RITTERS von NICOLE LOCKE
Wales, 1290. Eine Waldnymphe? Gebannt beobachtet Lord Teague of Gwalchdu die wunderschöne Frau, die leichtbekleidet auf der mächtigen Eiche herumklettert. Doch als sie aus luftiger Höhe wüste Beschimpfungen ausstößt, erkennt der Ritter seinen Irrtum. Sie ist keine Waldnymphe, sondern seine Feindin, die ihn für einen Verräter der walisischen Sache hält. Womöglich ist sie es auch, die in letzter Zeit Morddrohungen für ihn hinterlässt! Wie kann er sie überführen? Das Schicksal entscheidet für ihn: Sie stürzt vom Baum und bleibt bewusstlos zu seinen Füßen liegen. Er macht die begehrenswerte Anwen of Brynmor zu seiner willenlosen Gefangenen …
GEFANGEN IN DEN ARMEN DES FEINDES von JENNI FLETCHER
Der Feind steht vor den Toren ihrer Burg! Mutig und entschlossen tritt Lady Juliana dem Anführer der Truppen entgegen, um zu verhandeln. Doch mit Schrecken muss sie feststellen, dass Lothar nicht nur ein starker Krieger ist, sondern auch ein sinnliches Begehren in ihr weckt! Als Verhandlungspartner ist er absolut unnachgiebig. Es gibt nur eine Lösung: Sie muss ihn verführen, um ihn auf ihre Seite zu ziehen! Schon beim ersten Kuss entbrennt heiße Leidenschaft. Kann Juliana nicht nur ihre Burg, sondern auch ihr Herz vor seinem Ansturm verteidigen? Denn niemals darf Lothar erfahren, welches Geheimnis sie vor ihm verbirgt …
DIE UNWILLIGE BRAUT DES BASTARD-KRIEGERS von DENISE LYNN
Ein breitschultriger Fremder, dessen Gesicht im Schatten liegt: In einer Traumvision sieht die schöne Lady Lea of Montreau den Vater ihres Kindes. Sie braucht schnell einen männlichen Erben, sonst droht der Verlust ihrer Burg. Lea ist zu jedem Opfer bereit! Aber welch Schock, als Jared of Warehaven Einlass in ihre Feste begehrt und sie ihn als den Mann aus dem Traum erkennt. Ihm gehörte ihr Herz, bis Jared statt Liebe den Schwertdienst wählte. Der Bastard-Krieger, der Leben raubt und zärtliche Gefühle verschmäht, wird niemals ihr Lager teilen, schwört Lea! Doch auf verhängnisvolle Weise erfüllt sich ihre Vision …