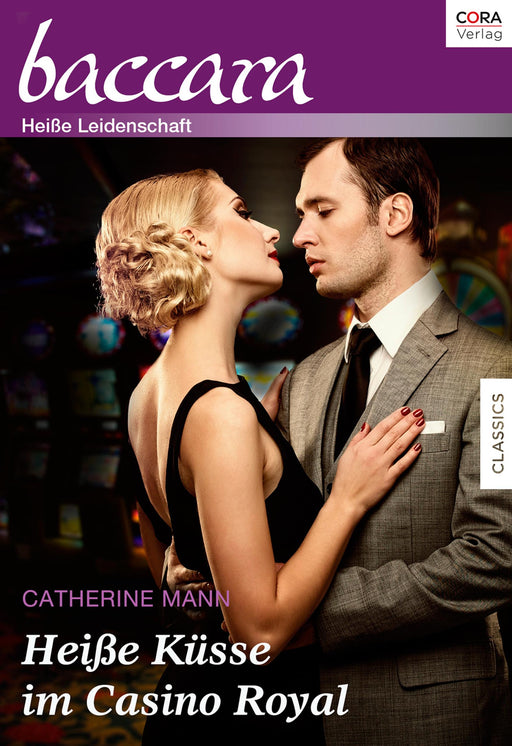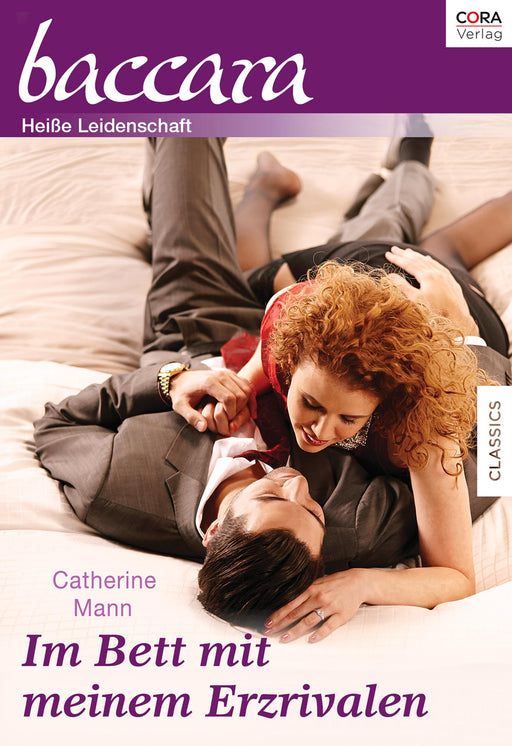Im Bett mit meinem Erzrivalen
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Ruhige Weihnachten? Nicht für Rowan. Erst verirrt sich seine Erzrivalin Mari aus Versehen in sein Hotelzimmer, dann entdecken sie auch noch ein ausgesetztes Baby! Um das will sich Rowan gern kümmern - aber nur gemeinsam mit Mari, die ihn insgeheim schon lange reizt …