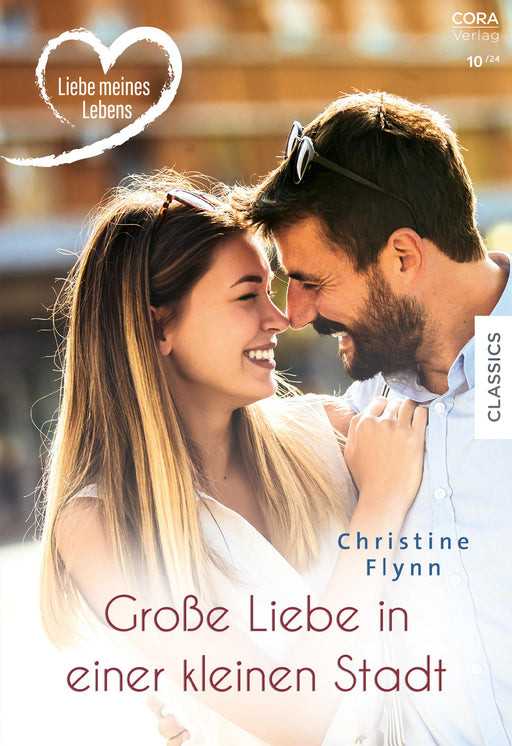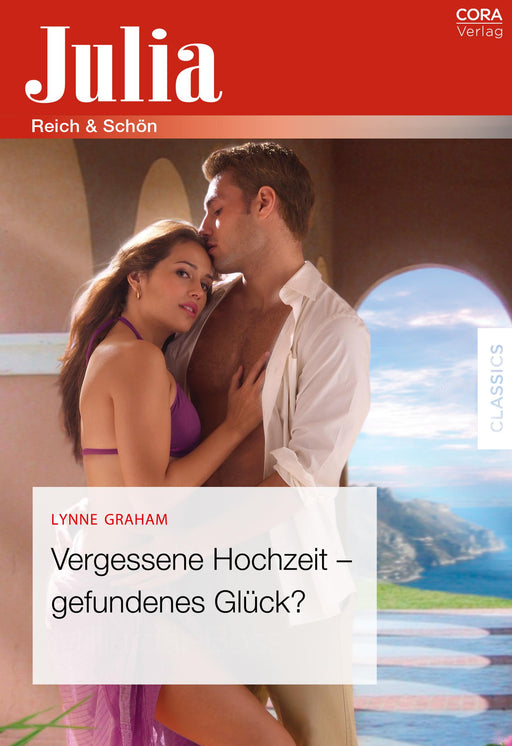Bittersüße Küsse auf dem Weihnachtsball
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
In der schönen Barbara erwacht bittersüße Leidenschaft, als der Fabrikbesitzer Joseph Stratford ihr auf dem Weihnachtball heimlich einen Kuss stiehlt. Aber sie darf sich nicht in ihn verlieben! Denn er wird schon bald eine andere heiraten ...