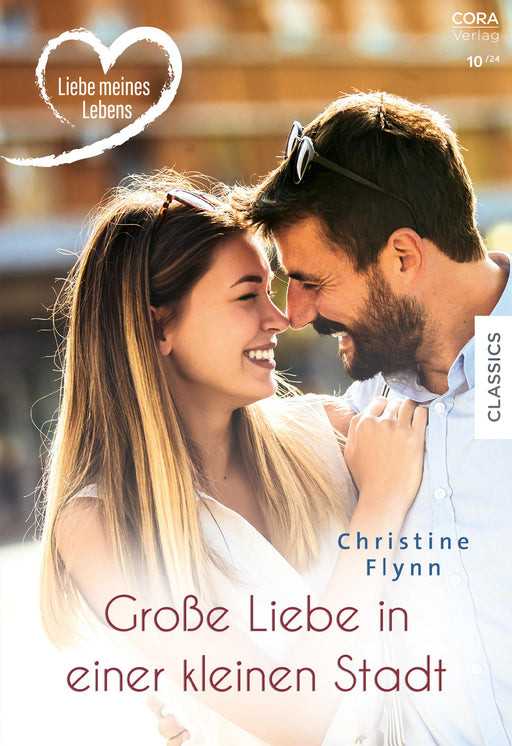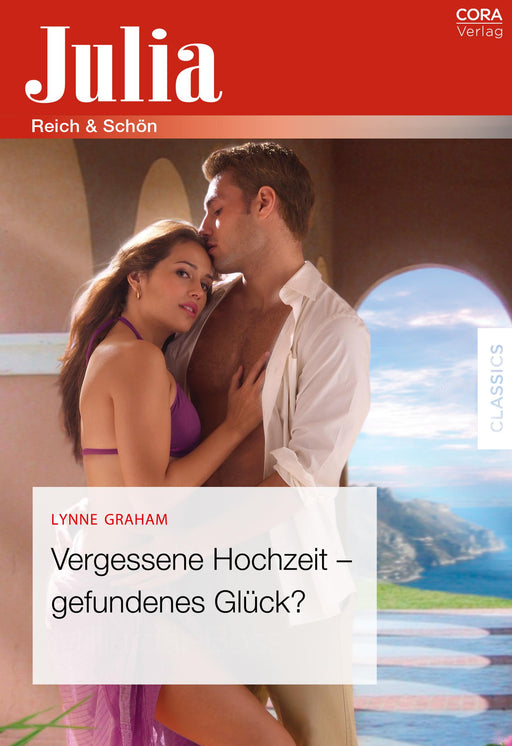Die Sklavin des blonden Wikingers
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
"Du gehörst mir." Ein Schauer überläuft die schöne Merewyn bei den Worten des hochgewachsenen Wikingers. Die Nordmänner haben ihre Siedlung an der Küste von Northumbria überfallen, und Merewyns intrigante Schwägerin hat sie dem Anführer Eirik als Sklavin überlassen! Ihr Schicksal ist besiegelt. Wenn es stimmt, was man über die grausamen Wikinger sagt, dann sollte Merewyn alles daran setzen zu fliehen, bevor Eirik sie auf seinem Langschiff über das Meer entführt! Stattdessen ist sie gebannt von dem blauen Feuer in seinen Augen, das etwas ganz anderes als ewige Verdammnis zu versprechen scheint …