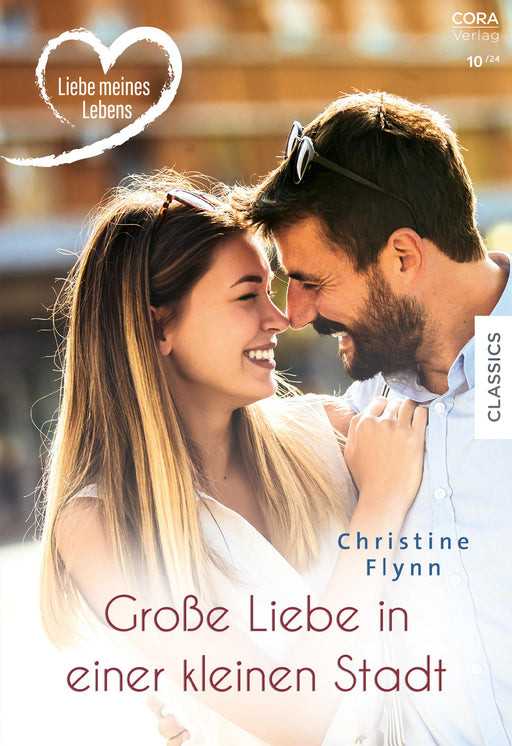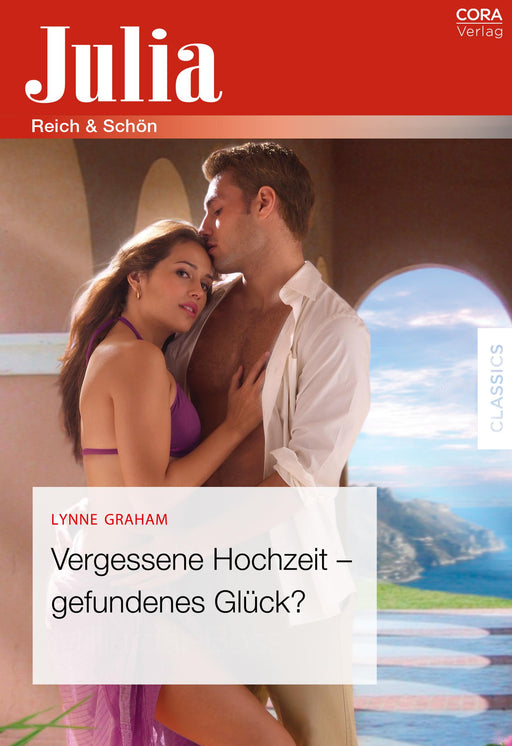Historical Lords & Ladies Band 67
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
DER EARL UND SEIN VERFÜHRERISCHER ENGEL von WILLINGHAM, MICHELLE
"Wer sind Sie?" Als Stephen, Earl of Whitmore, aus seiner Ohnmacht erwacht, blickt er in das Gesicht eines Engels. Doch er befindet sich nicht im Himmel, sondern in seinem Schlafzimmer. Und so überirdisch schön die junge Frau an seinem Bett ist, so höllisch wütend ist sie auch. Hat er wirklich ihren Bruder auf dem Gewissen? Stephen kann sich an nichts erinnern - auch nicht daran, dass sie angeblich seine Ehefrau ist.
MISS LILY VERLIERT IHR HERZ von MARLOWE, DEB
Ihr erster Ball in London, endlich hat Lily sich von den Fesseln ihrer strengen Mutter befreit! Mit ihrem Charme verdreht sie allen Junggesellen den Kopf - aber sie will nur Jack Alden, den kühlen und doch so wagemutigen und attraktiven Gentleman. Schon beim ersten Blick in seine Augen hat sie ihr Herz verloren! Seine sehnsüchtigen Küsse verraten ihr, dass die Arroganz nur eine Mauer ist, hinter der er seine Gefühle zu verbergen sucht. Einen Sommer lang hat Lily Zeit, diesen Schutzwall zu durchbrechen - wenn sie scheitert, muss sie zurück in das graue Leben an der Seite ihrer Mutter …