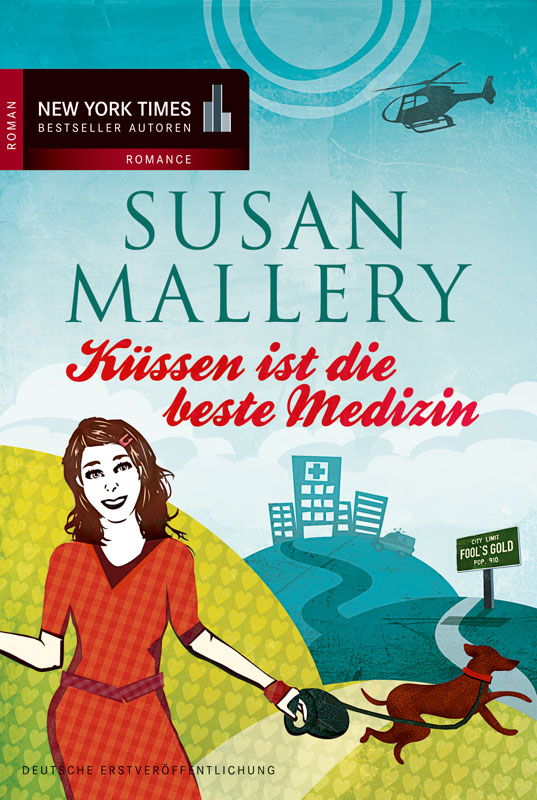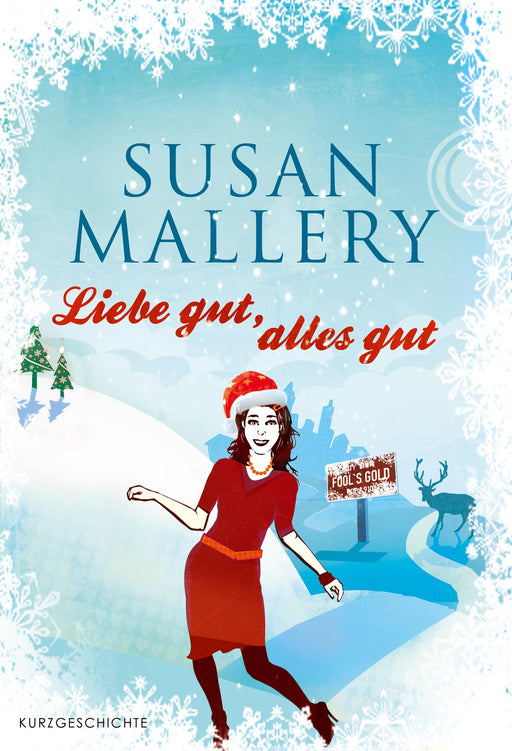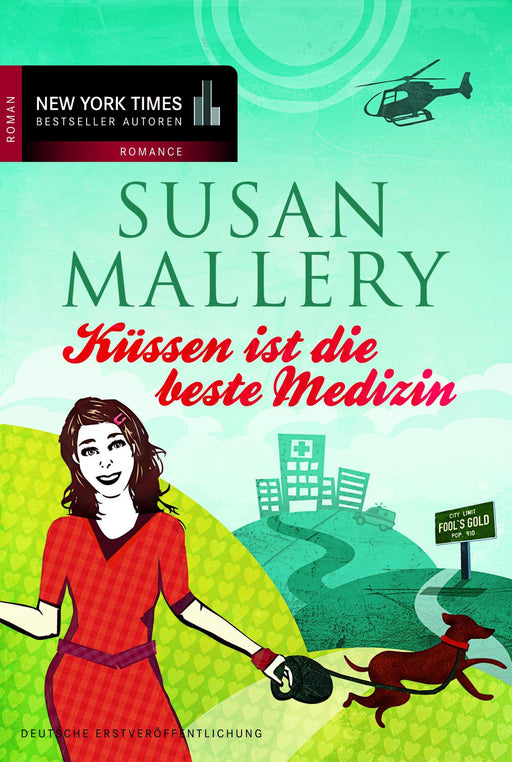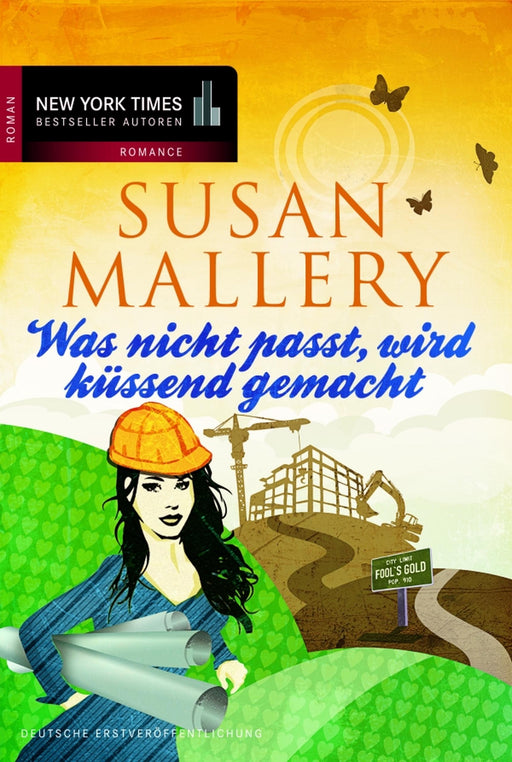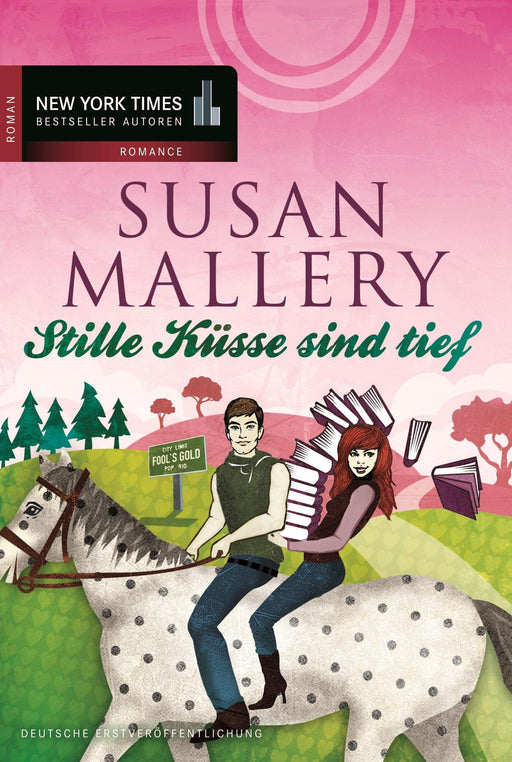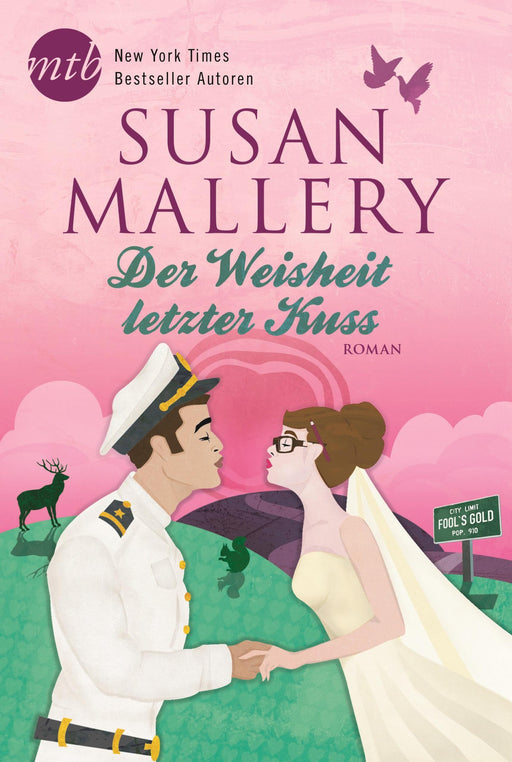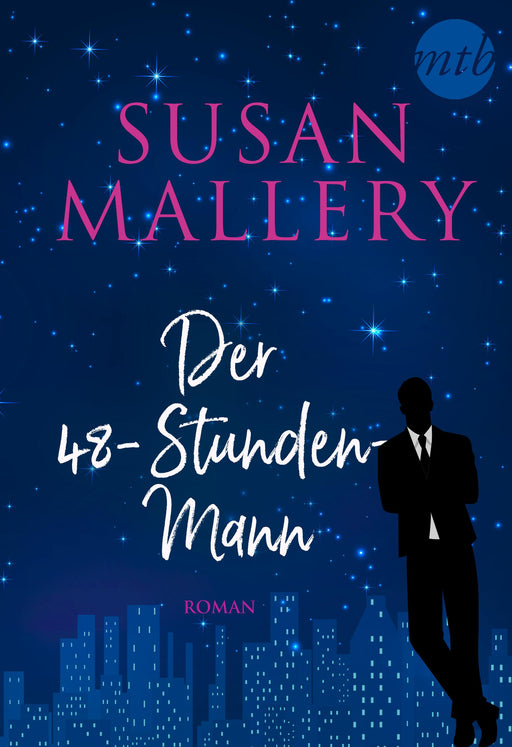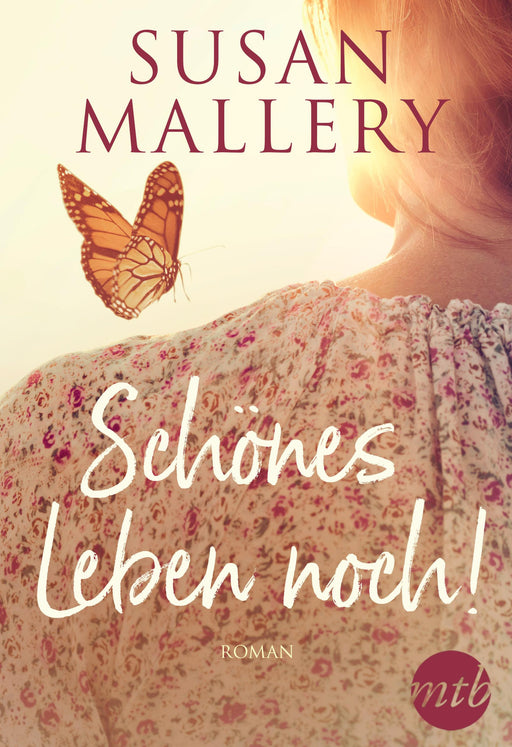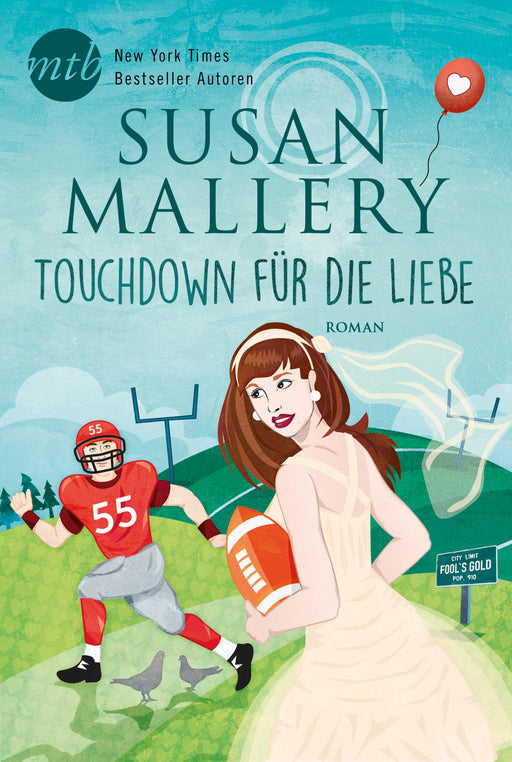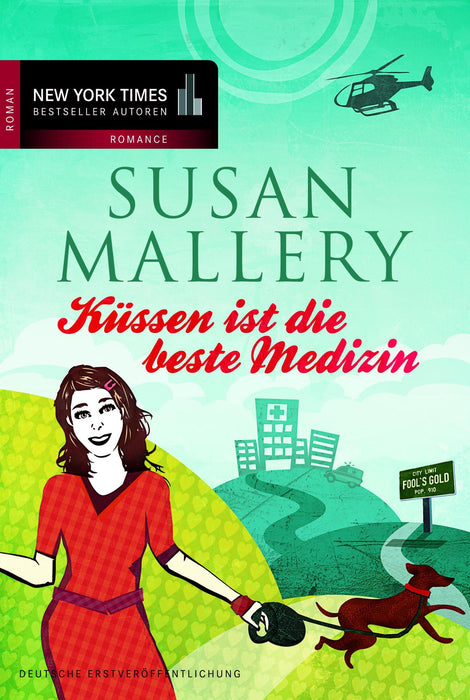
Küssen ist die beste Medizin
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Willkommen in Fool’s Gold, wo am Ende des Regenbogens die große Liebe wartet!
Montana Hendrix hat eine Berufung: die Ausbildung von Therapiehunden. Denn was könnte besser sein, wenn man traurig oder krank ist, als mit einem Hund zu kuscheln? Leider sehen das nicht alle so. Als Montana in einer Klinik auf den Chirurgen Simon Bradley trifft, fliegen die Fetzen - und die Funken. So wütend Simon auch ist: Er erkennt, wie glücklich der Hundebesuch seine kleine Patientin macht, und bittet Montana, regelmäßig vorbeizukommen. Und wie das mit Frauen immer so ist - reicht man ihnen den kleinen Finger, nehmen sie gleich die ganze Hand. Und das Herz. Und die Seele. Und eh man sich versieht, ist man Hals über Kopf verliebt. Ein Zustand, für den es nur zwei Lösungen gibt: Weglaufen - oder bis ans Lebensende glücklich werden.