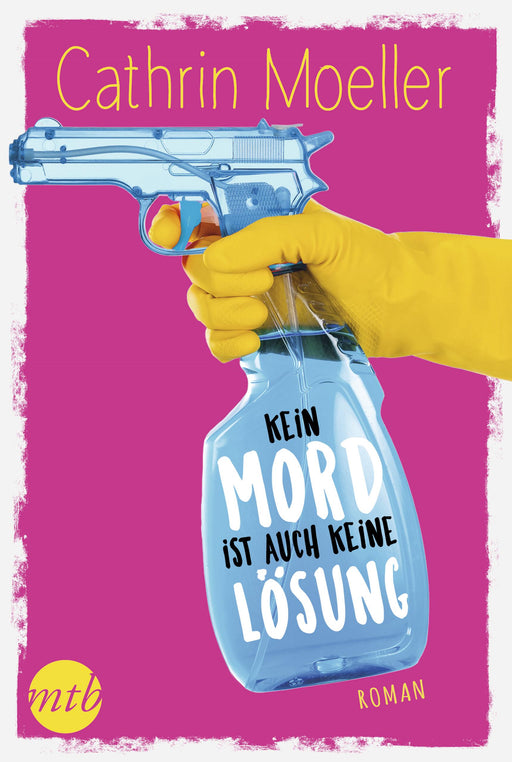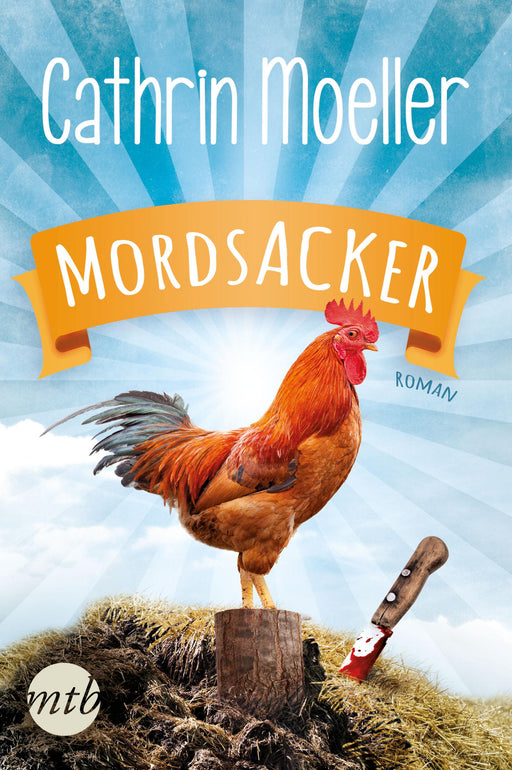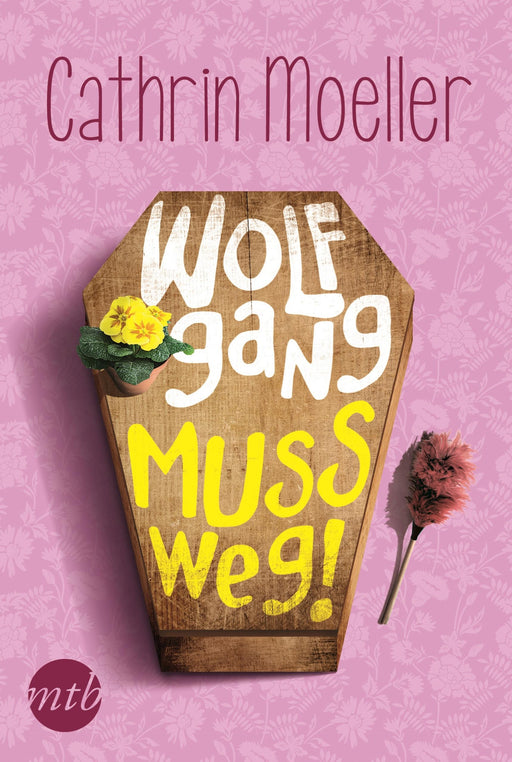Die Spreewaldgurkenverschwörung
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Schon immer stand Apothekenhelferin Helene im Schatten ihrer schönen und gnadenlos gemeinen Schwester, der Staatsanwältin Lisa. Bei jeder Gelegenheit wird sie von ihr in die Pfanne gehauen. Doch als Lisa sie nun wegen Mordverdacht in Untersuchungshaft bringt, geht sie echt zu weit. Helene ist doch nur zufällig beim Medikamente ausliefern über diese Leiche gestolpert und dann hat sie halt dummerweise das Messer rausgezogen und dann war da überall Blut … Da kann sie doch nix dafür! Frisch aus dem Gefängnis entlassen schwört sie Rache. Die Einladung zu einem Schwesternwochenende im Spreewald passt da perfekt. Jetzt wird abgerechnet! Doch irgendwas ist faul im Spreewald und das Chaos stets nur ein Gurkenglas entfernt …