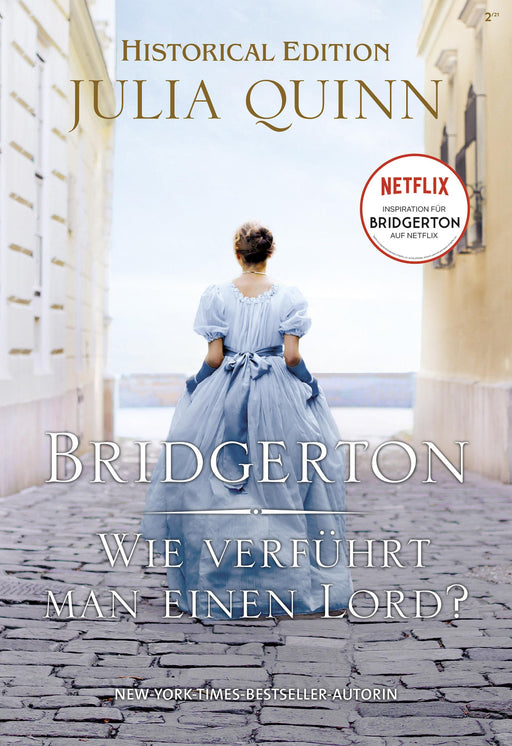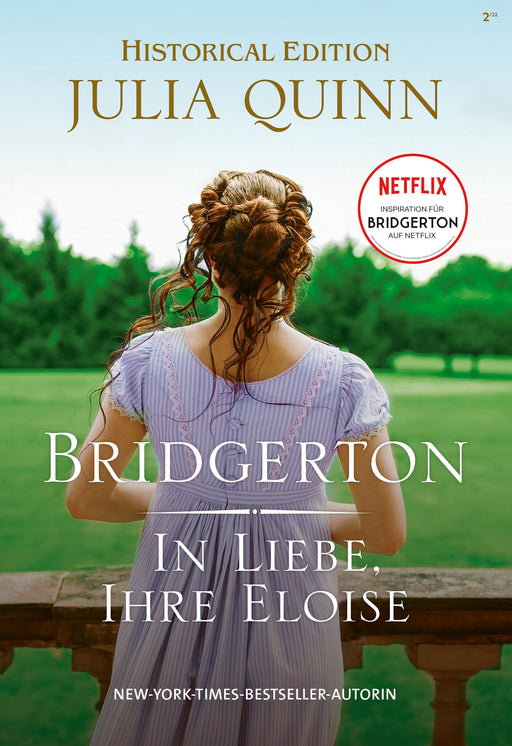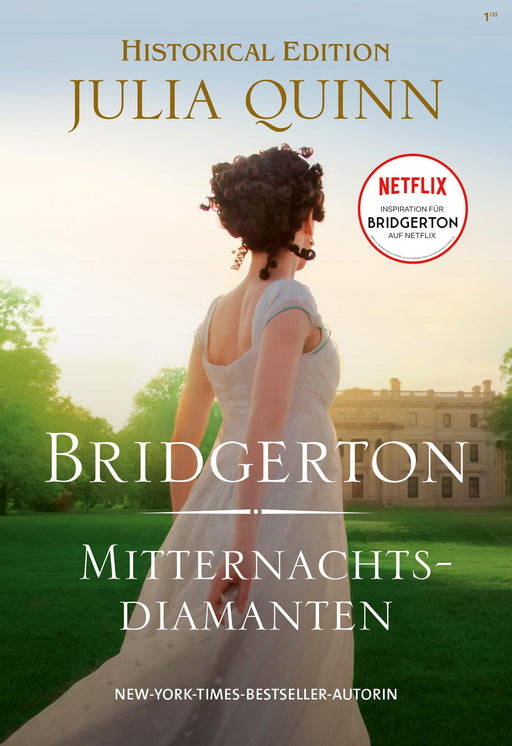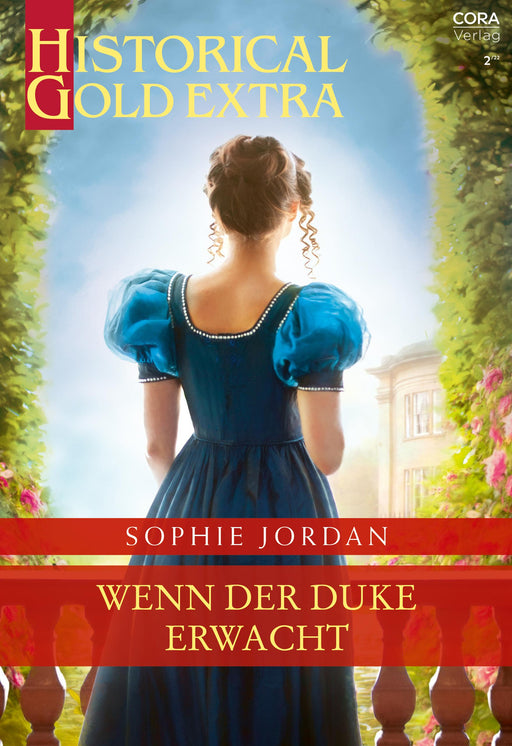Baccara Collection Band 450
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
DUNKLE NÄCHTE IN NEW ORLEANS von TORI CARRINGTON
Eine Frau wie Molly Laraway bedeutet nur Ärger! Da ist sich Detective Alan Chevalier sicher. Erstens sieht sie so gut aus, dass sie ihn von seinen Ermittlungen ablenkt, und zweitens ist sie das Ebenbild ihrer verstorbenen Zwillingsschwester, deren Mörder er jagt!
NIEMAND IST SO HEISS WIE DU von MAUREEN CHILD
Nach einem Brand ist Bauunternehmerin Hannah die letzte Hoffnung für das Restaurant von Bennett Carey. Doch ihre Art treibt ihn zur Weißglut! Normalerweise würde er sie feuern, wenn er sie nicht für sein Restaurant bräuchte – und sie gleichzeitig nicht so verdammt sexy wäre …
MEHR ALS DIESER EINE KUSS? von SHERELLE GREEN
Weil sie ihm mit seinem kleinen Neffen hilft, kommt Kindergärtnerin Kiara dem erfolgreichen Trey Moore näher. So nah, dass er ihr sogar einen atemberaubenden Kuss schenkt! Doch verlieben darf sich Kiara auf keinen Fall – denn sie weiß genau, dass sie für Trey die Falsche ist!