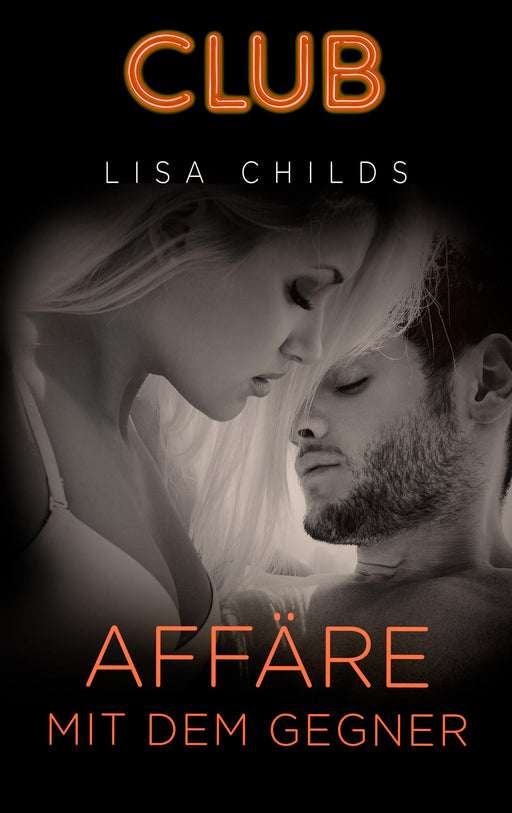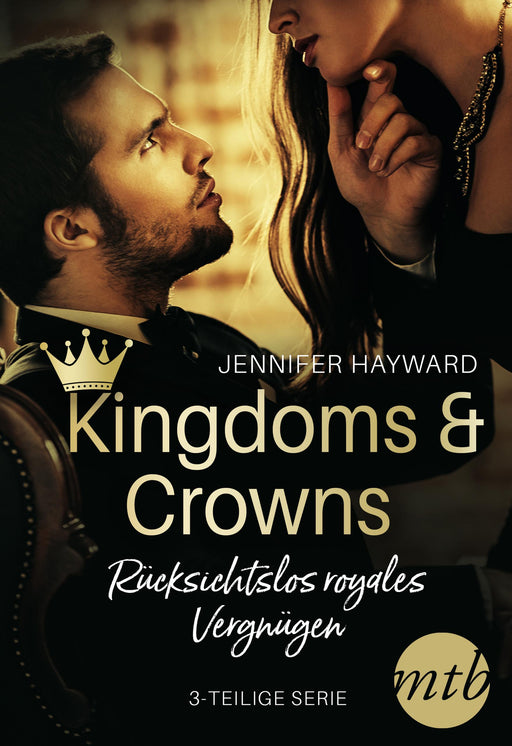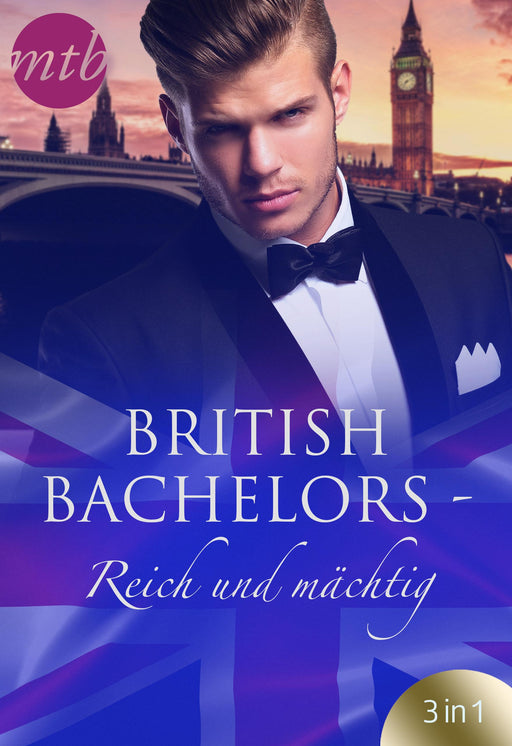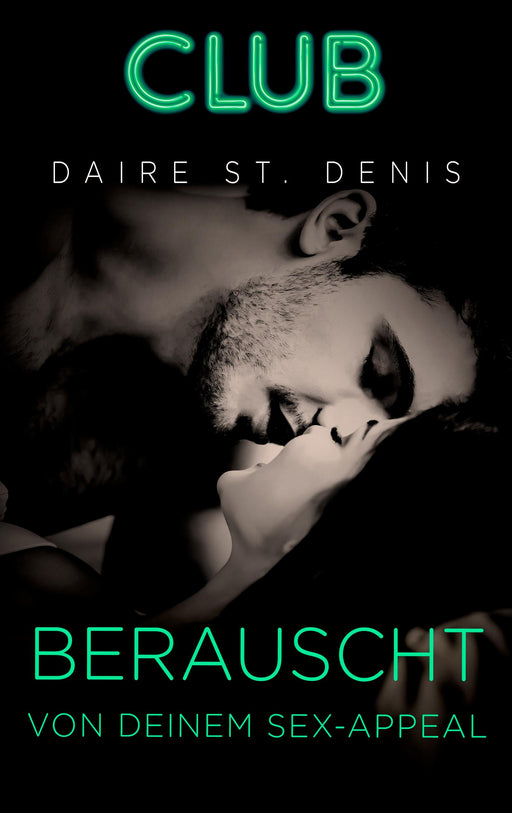Das Flüstern der Gefahr
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Er lässt keinen seiner Leute zurück. Schon gar nicht die Frau, die er liebt.
Jinas Stimme bringt ihn um den Verstand. Dabei muss sich Levi Butcher konzentrieren. Er ist als Teamleader für seine Eliteeinheit verantwortlich. Wenn er im Einsatz ist, ist er mit Jina über Funk verbunden. Aber er kann kaum an etwas anderes denken als an ihre sinnlichen Lippen und heißen Kurven. Als sie im Einsatz sind und plötzlich das Basislager attackiert wird, reißt der Kontakt zu Jina ab. Was ist mit ihr passiert? Levi muss sie finden, bevor es zu spät ist.