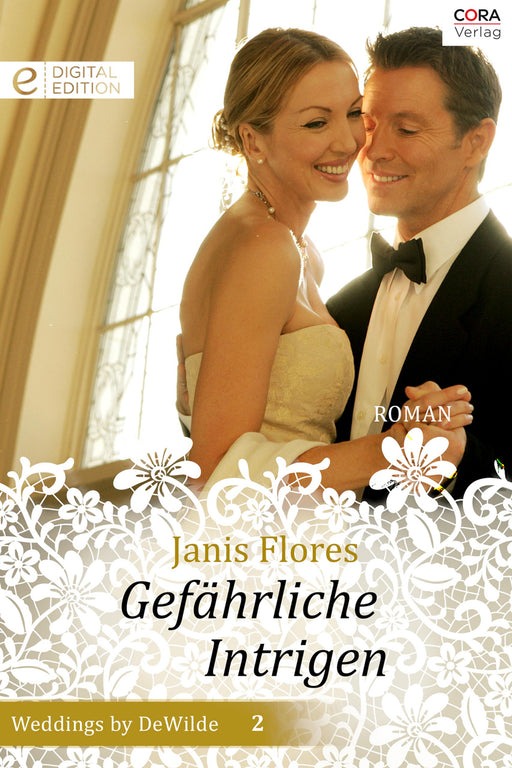Das Kind der Liebe
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
An die Kraft der Liebe kann Mallory Powell, die Tochter von Grace DeWildes älterem Bruder Leland, nicht glauben. Doch eine einzige sensationelle Nacht auf einem Schweigeseminar verändert ihr ganzes Leben. In den Armen eines völlig Fremden erlebt sie Lust, Ekstase und totale Hingabe. Als sie sich später wiedersehen, weiß Mallory, dass sie sein Baby erwartet. Wie wird Liam O'Neill auf diese Nachricht reagieren?