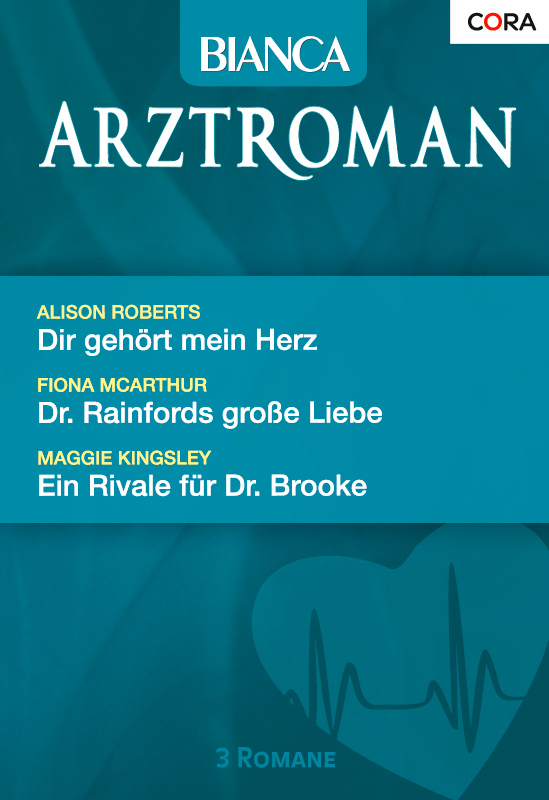Bianca Arztroman Band 62
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Dir gehört mein Herz von Roberts, Alison
Schwester Jessica lebt nur für ihren kleinen Sohn Ricky - sie hat keine Augen für ihren verliebten Kollegen Joe. Erst als der Rettungssanitäter sein Leben riskiert, um ihren Jungen aus den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes zu befreien, merkt sie, wie viel auch er ihr bedeutet... Zu spät?
Dr. Rainfords große Liebe von McArthur, Fiona
Im Gladstone Hospital begegnet die Hebamme Bella ihrer Jugendliebe Dr. Scott Rainford. Als sie zusammen mit dem gut aussehenden Arzt auf der Entbindungsstation arbeitet, fühlt sie sich sofort wieder zu ihm hingezogen. Bekommt ihre Liebe womöglich eine zweite Chance?
Ein Rivale für Dr. Brooke von Kingsley, Maggie
Obwohl Dr. Tom Brooke und seine Frau Helen, ebenfalls Ärztin, wenig Zeit füreinander haben, führen sie auch nach zehn Jahren eine harmonische Ehe - glaubt Tom. Bis er annehmen muss, dass es einen anderen Mann in Helens Leben gibt. Oder für wen hat sie dieses betörende Negligé gekauft, das er zufällig entdeckt?