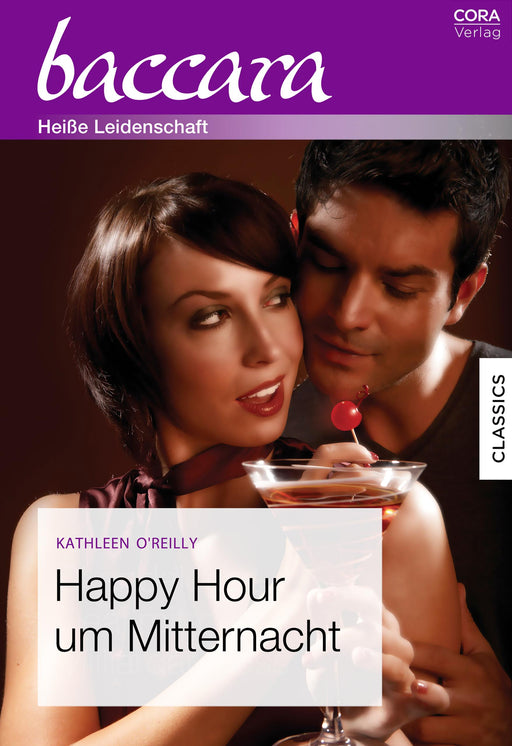Traumhaus am Meer - Liebe inklusive?
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Völlig überraschend erbt Abby ein Traumhaus am Meer! Doch die Sache hat zwei Haken: Das geheimnisvolle Testament schreibt vor, dass sie innerhalb eines Jahres verheiratet sein muss. Und es gibt einen verboten attraktiven Mieter in ihrer neuen Immobilie. Shane McCall will zuerst sofort ausziehen – dann aber bleibt er und flirtet heiß mit ihr! Doch selbst in ihren kühnsten Träumen weiß die alleinerziehende Mutter, dass Shane ihre größte Sehnsucht niemals erfüllen wird. Denn eine Heirat oder gar eine Familie sind für den bindungsscheuen Witwer ausgeschlossen …