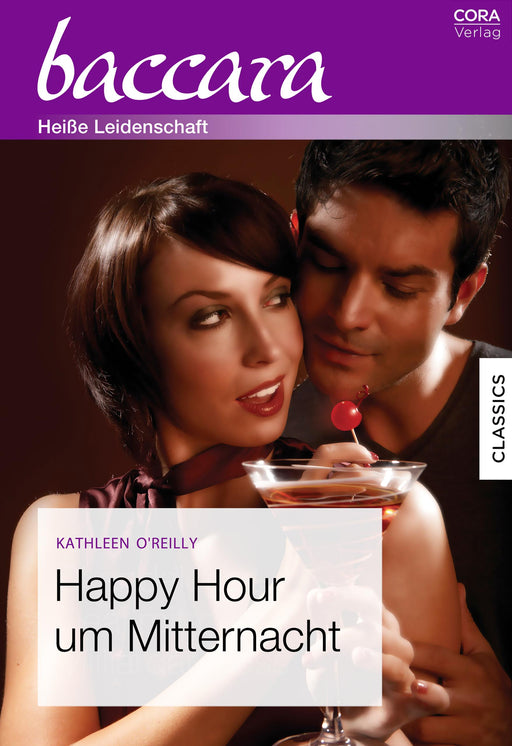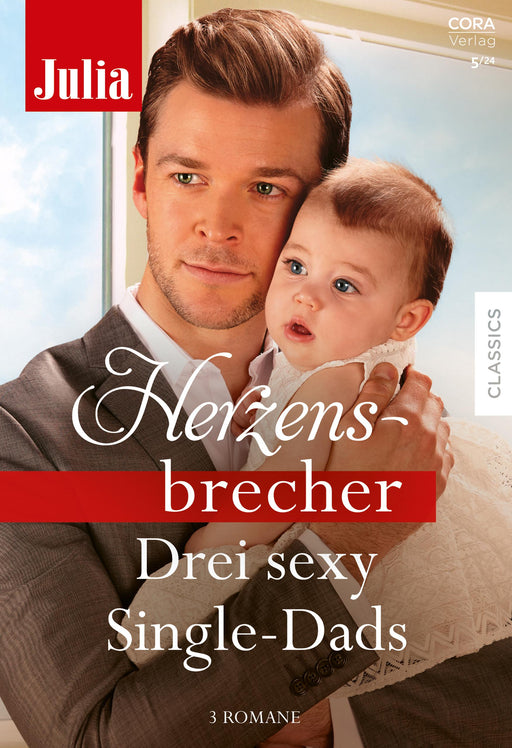Ein Duke für immer und ewig?
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
"Er hat meine Schwester ermordet!" Ein entsetztes Raunen geht durch die geschmückte Kirche am Hanover Square. Gerade will die schöne Musiklehrerin Dora dem begehrten Adligen George Crabbe, Duke of Stanbrook das Jawort geben, da erhebt einer der vornehmen Gäste lautstark diese unerhörten Vorwürfe. Zwar wird er von Georges Freunden rasch aus der Kirche entfernt, aber tiefe Zweifel überkommen Dora. Sie weiß, dass der schneidige Duke verwitwet ist, weil seine erste Frau angeblich den Freitod wählte. Aber was, wenn die Beschuldigungen stimmen? Hat die Liebe sie verblendet - ist der Duke, den sie gleich heiraten wird, ein gewissenloser Mörder?