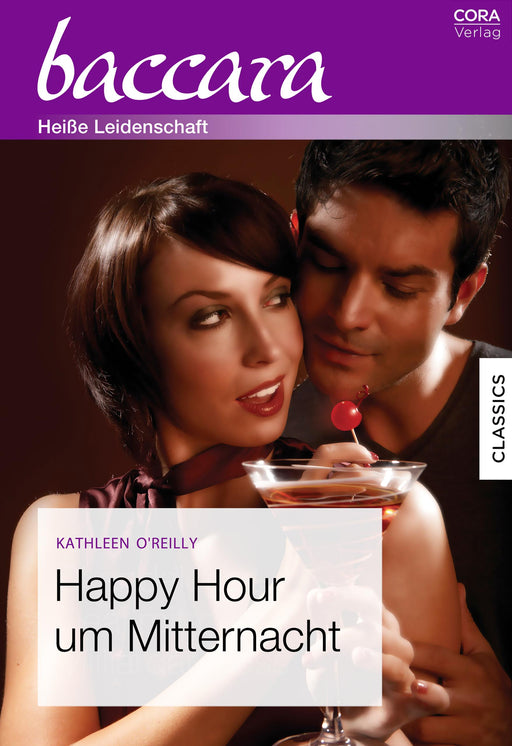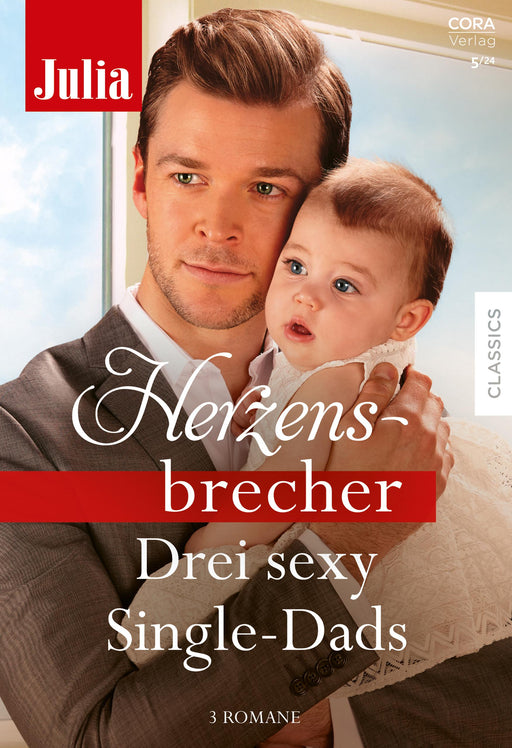Historical Exklusiv Band 85
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
VENEZIANISCHE VERSUCHUNG von MIRANDA JARRETT
Wach ich, oder träum ich? Richard Farren, Duke of Aston, traut seinen Augen nicht. Denn die Schönheit mit dem offenen Haar und dem verführerischen Nachtgewand, die in sein Schlafgemach stürmt, ist Miss Wood! Was ist nur in die stille Gouvernante gefahren, die seine Töchter nach Venedig begleitet hat? Doch Jane Woods entfesseltes Temperament ist längst nicht die einzige Überraschung, die den Duke in der Lagunenstadt erwartet …
SIEG DER LIEBE von MIRANDA JARRETT
So verführerisch und betörend wie die Rosen in ihrem Garten wirkt die junge Braut Jerusa Sparhawk im Sommer 1771 kurz vor ihrer Hochzeit. Der Mann, der ihr im Schatten der Bäume auflauert, hat jedoch keine Augen für ihre Schönheit. Mit einem finsteren Racheplan im Herzen entführt Michel Géricault die ahnungslose Jerusa nach Martinique. Doch bald spürt er, dass die Liebe heißer als jede Rache brennen kann …