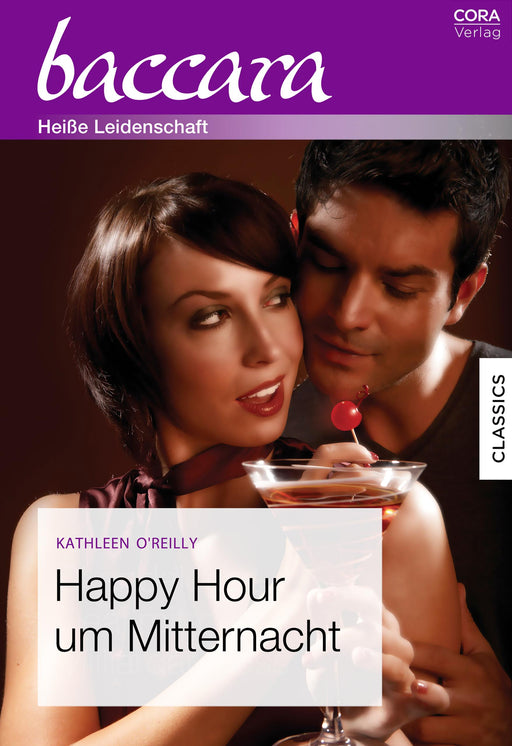Kein Duke wie jeder andere
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Damit hätte Lady Ana Maria nie gerechnet: Die Herren der Gesellschaft umschwärmen sie derart ungestüm, dass sie sich die zahlreichen Heiratskandidaten kaum vom Leibe halten kann. Deshalb sorgt ihr Bruder dafür, dass sein Freund Nash, der Duke of Malvern, ihr zeigt, wie man sich gekonnt gegen aufdringliche Verehrer zur Wehr setzt. Während sich die meisten Ladies von dem düsteren Duke eingeschüchtert fühlen, genießt Ana Maria seine Gegenwart. Und bei den täglichen Lektionen kommt er ihr so erregend nahe, dass sie sich nach mehr sehnt … Doch der Duke macht ihr unmissverständlich klar, dass er niemals heiraten will!