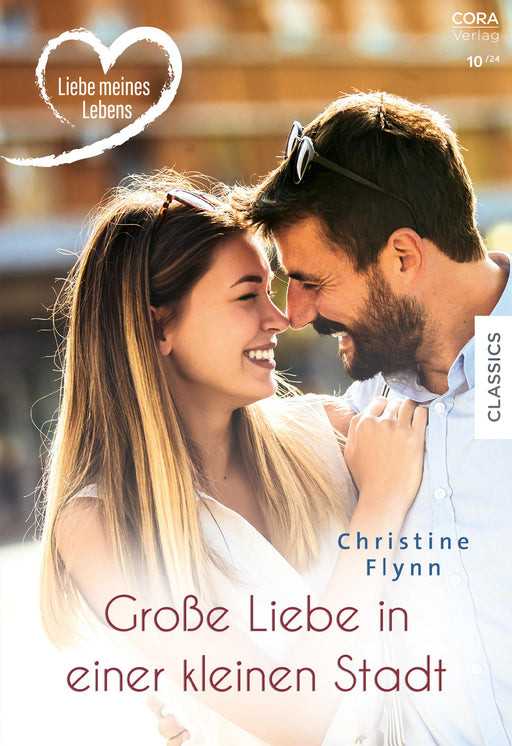Auf Brautschau mit einer Lady
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Was tut eine Lady in einer Spielhölle? Thomas Sharpe ist schockiert, als er die Schwester seines besten Freundes in einem skandalträchtigen Club trifft. Er muss ihren Ruf retten! Dabei hat der Lebemann bereits genügend eigene Probleme: Weil sein Vater das Familienvermögen verloren hat, muss Thomas schnellstens das Herz – und vor allem die Hand – einer reichen Erbin gewinnen, um sein Auskommen zu sichern. Unverhofft bietet Jane ihm Hilfe bei der Brautschau an, wenn er im Gegenzug ihre Abenteuerlust unterstützt. Bald fühlt Thomas, dass die unkonventionelle Lady die ideale Frau an seiner Seite wäre. Doch Jane ist leider völlig mittellos …