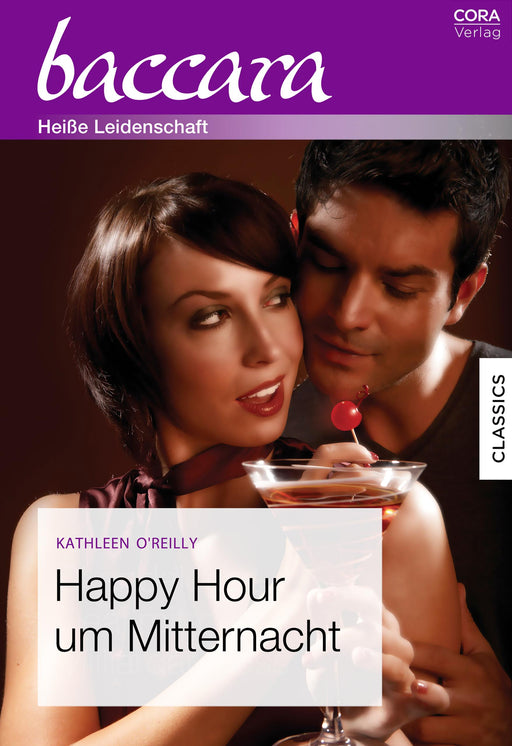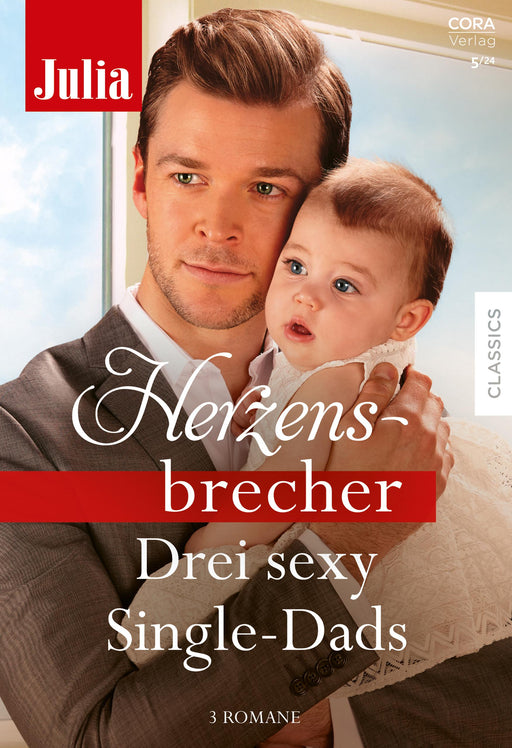Wie zähmt man eine Prinzessin?
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Mit Lucas Garcia an den Hof von Arunthia reisen? Niemals! Seit ihre Eltern sie als Kind in eine Londoner Klinik verbannten, hat Prinzessin Claudine mit dem Königshaus gebrochen. Ihre schwere Krankheit hat die Schöne zwar besiegt, ihre Selbstzweifel jedoch nicht. Ist es Begierde oder Ablehnung, die in Lucas’ Augen steht? Die unerfahrene Claudine weiß es erst, als der sexy Bodyguard sie nach einem Streit mit einem leidenschaftlichen Kuss bezähmt. Doch sie darf ihrem jäh erwachten Verlangen nicht nachgeben. Denn Lucas nutzt jede Schwäche, um sie in den Palast zurückzuzwingen …