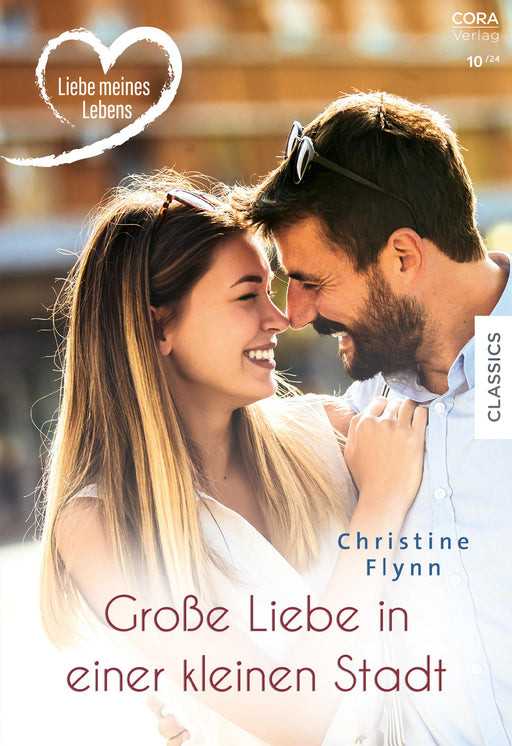Verführt im Harem des Scheichs
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
"Sie meinen, ich soll in Ihrem Harem leben?" Schockiert senkt Lady Celia den Blick vor Scheich Ramiz. Was, wenn es wahr ist, was Schehezerade in 1001 Nacht über den geheimnisvollen Ort erzählt? Auf purpurner Seide harren die Haremssklavinnen unschuldig und unbekleidet ihres Herrn und ... Gewiss, ihre Erziehung als Lady untersagt weitere Fantasien. Aber fern von England, allein mit einem faszinierenden Wüstenprinzen … Fragend blickt Celia wieder auf und entdeckt ein Glitzern in Ramiz‘ dunklen Augen, das sie erschauern lässt. Und hoffen, dass Schehezerade nicht gelogen hat …