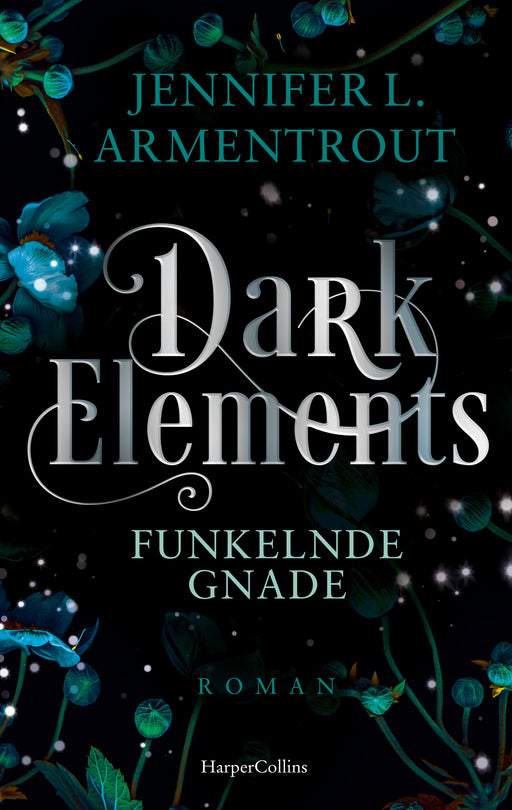Dark Elements 4 - Glühende Gefühle
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Zayne hat viel durchgemacht: Der attraktive Gargoyle-Wächter mit den eisblauen Augen hat seine große Liebe Layla an den Dämonenprinzen Roth verloren, und sein Vater ist im Kampf gefallen. Doch Zayne kann sich nicht länger in seinem Schmerz vergraben, denn ein unbekanntes Wesen macht Jagd auf die Wächter. Um diese Bedrohung aufzuhalten, wendet er sich an einen anderen Gargoyle-Clan. Zu seiner Überraschung lebt dort eine Sterbliche – Trinity, bei der sein Herz wieder etwas fühlt. Aber sie umgibt ein Geheimnis. Hängt es womöglich mit den Angriffen auf die Gargoyles zusammen?
»Jennifer L. Armentrouts packendes, neues Fantasywerk ist bisher ihr bestes.«
New-York-Times-Bestsellerautorin Gena Showalter