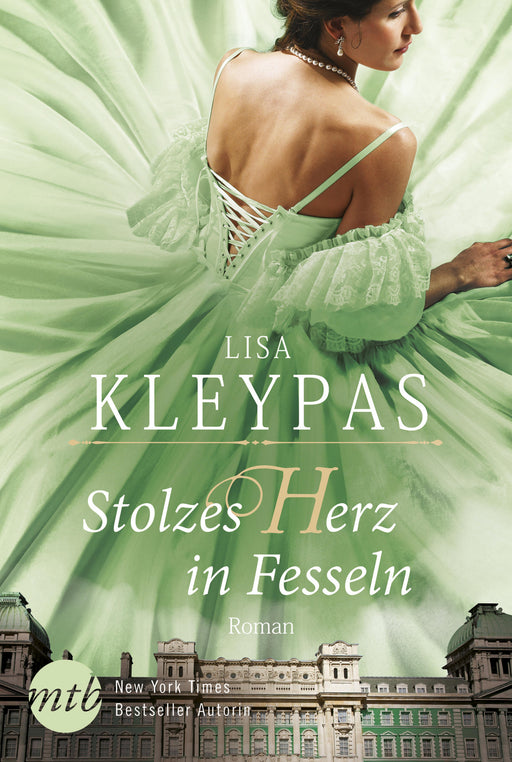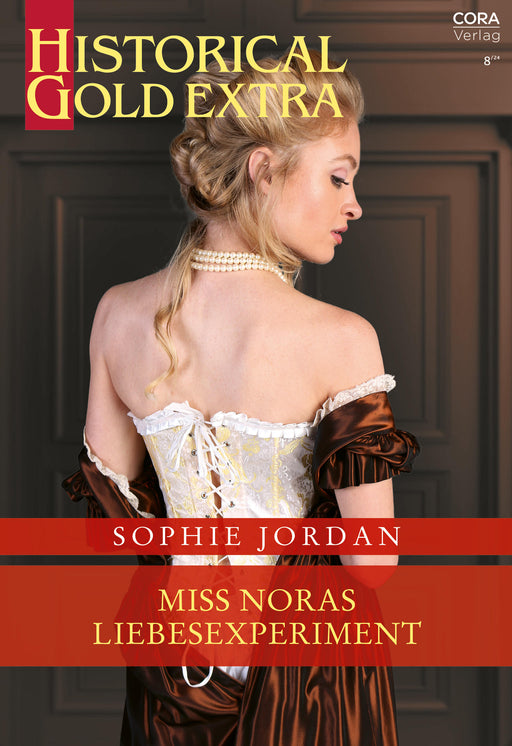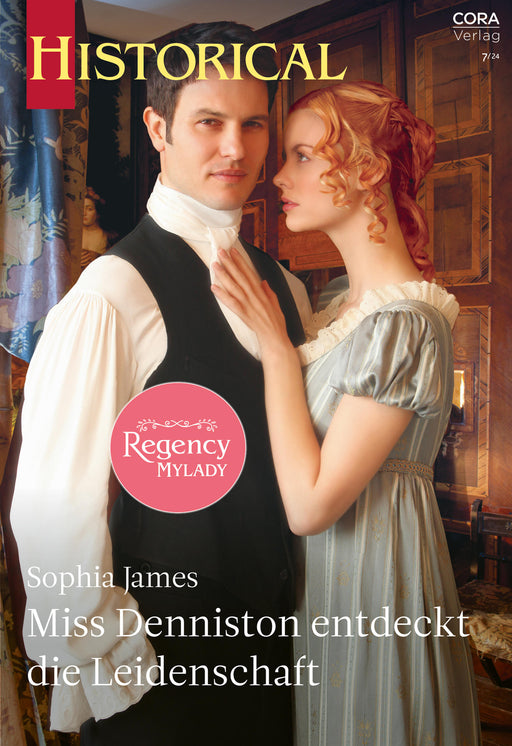Dem Earl ausgeliefert
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
"Einen Schurken erkennst du am unzüchtigen Glimmen in seinen Augen, der Leichtigkeit seines Charmes und seiner animalischen Anziehungskraft!" Betroffen muss Lady Kathleen an die warnenden Worte ihrer Ziehmutter denken, als sie vor Devon Ravenel, dem neuen Earl of Trenear, steht. Denn verhängnisvoll gut passt diese Beschreibung auf ihn. Plötzlich fühlt sich die irische Schönheit ganz schwach. Als junge Witwe hängt ihre Zukunft von Devon, dem Erben ihres verstorbenen Mannes, ab. Mit einer Handbewegung kann dieser verwegene Schurke sie des Anwesens Eversby Priory verweisen - oder noch Schlimmeres von ihr verlangen …
"Kleypas ist eine Meisterin ihres Fachs."
Kirkus Reviews