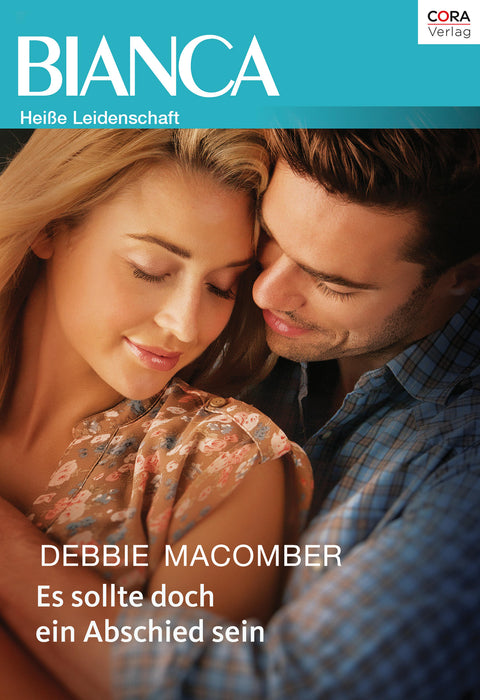
Es sollte doch ein Abschied sein
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Eine letzte Nacht will Molly in Jordans zärtlicher Umarmung verbringen. Dann soll mit der Scheidung endlich der Abschied folgen. So hat sie es sich vorgestellt - und nicht damit gerechnet, ausgerechnet jetzt schwanger zu werden! Von Jordan, der längst eine Andere hat …












