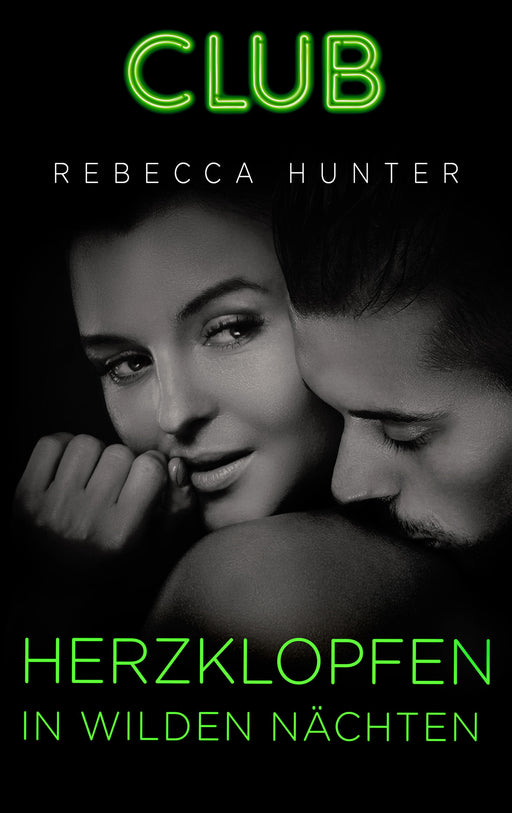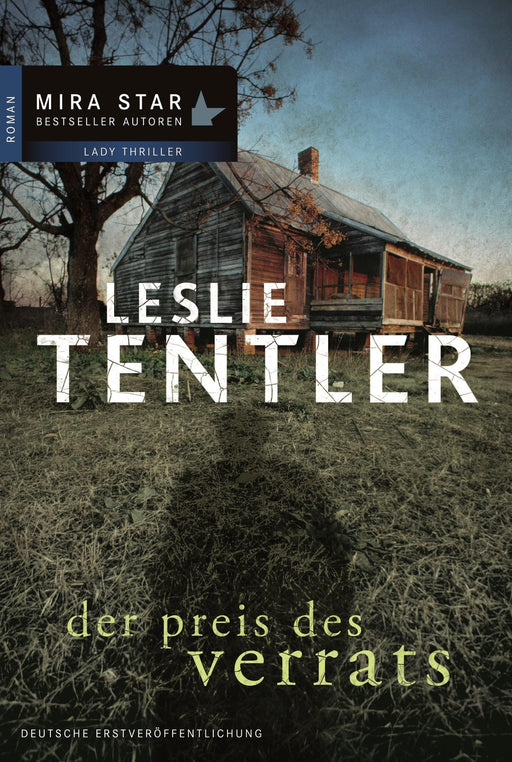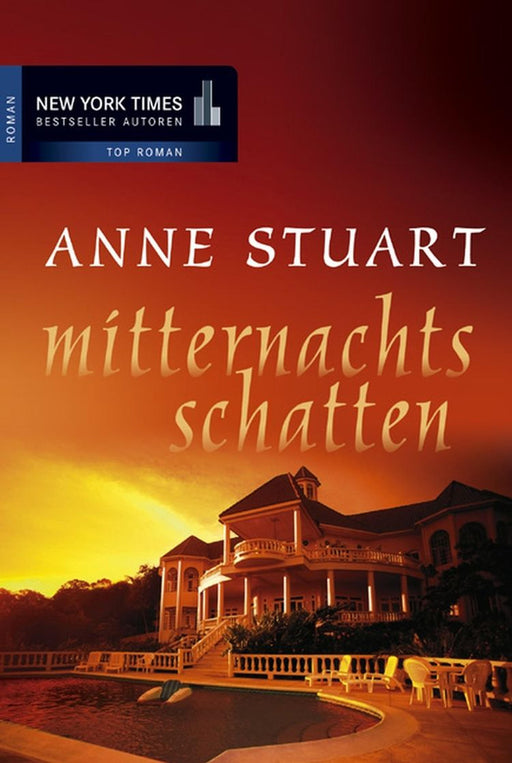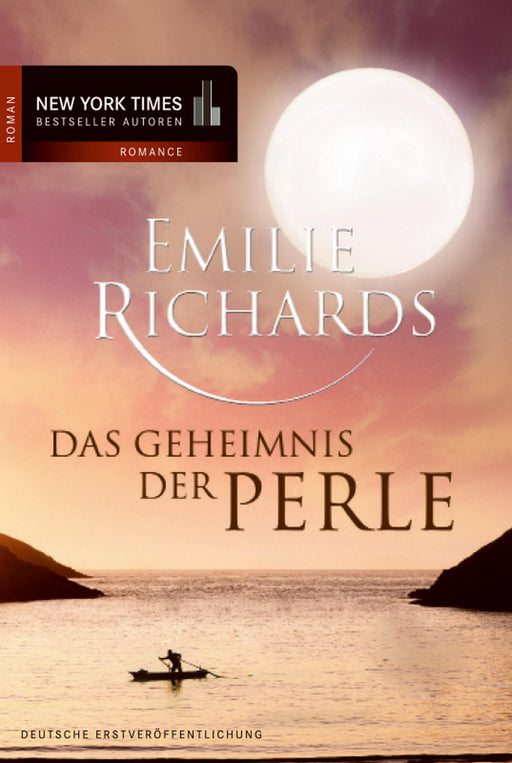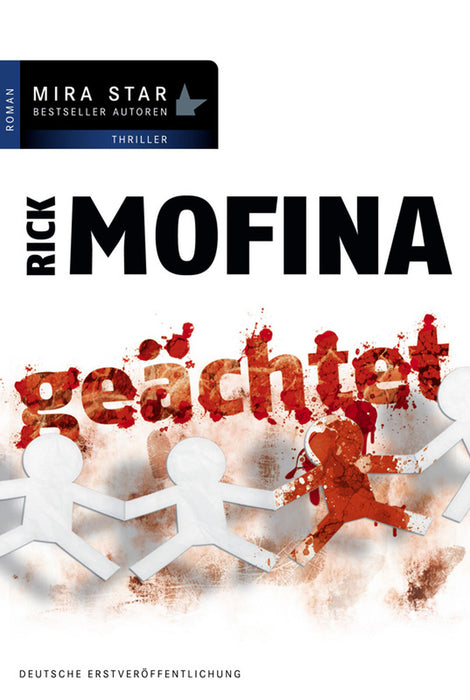
Geächtet
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Rick Mofinas neuer Jack-Gannon-Thriller: Eine verzweifelte Mutter und ein unerbittlicher Reporter im Fadenkreuz einer tödlichen Verschwörung.
Eine Bombenexplosion in einem Café in Rio …
Zehn Menschen sterben, darunter zwei Journalisten. Waren sie unschuldige Opfer - oder Ziel des Anschlags, weil sie zu viel wussten? Der Reporter Jack Gannon recherchiert den Fall.
Ein Autounfall in Wyoming …
Eine Frau klettert aus dem brennenden Wrack. Sie meint zu sehen, wie jemand ihr Kind aus den Flammen zieht. Doch dann wird sie ohnmächtig - und ihr Sohn verschwindet spurlos.
Eine Karibikkreuzfahrt mit grausigem Ende …
Verzweifelt fahnden die Ärzte nach dem Grund für die Todesqualen eines Passagiers und fördern Unglaubliches zutage: Jemand missbraucht ein Virus aus dem Genlabor - als tödliche Waffe gegen die Menschheit. Und während eine Mutter ihr Kind und Jack Gannon die Wahrheit sucht, beginnt ein gnadenloser Wettlauf gegen die Zeit …