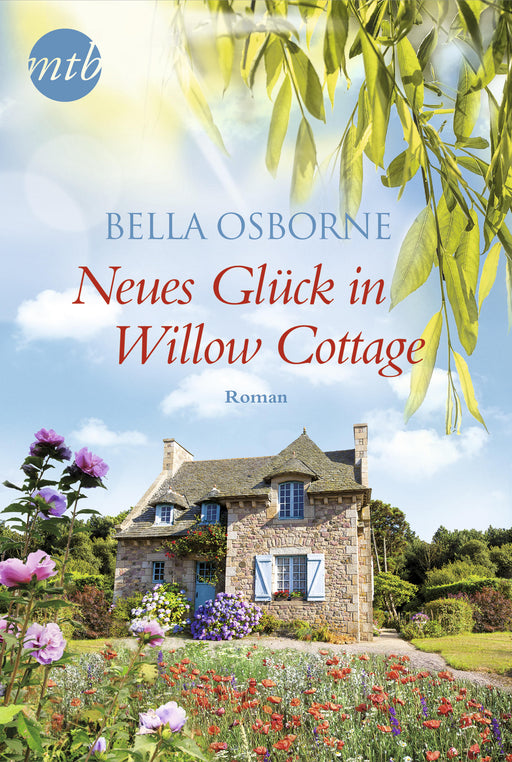Wacholderglück
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Daisy ist eine Weltenbummlerin. Solange sie reist, ist sie glücklich. Allerdings hat ihr Großonkel ihr jetzt ein wunderschönes altes Bahnhofsgebäude vererbt. Bei dem Gedanken an den renovierungsbedürftigen Bau hat Daisy sofort Hunderte Ideen, was man daraus machen kann. Doch es gibt eine Bedingung: Um das Erbe anzutreten, muss sie ein Jahr lang in Ottercombe Bay bleiben, dem Ort, in dem so viele Erinnerungen auf Daisy warten, die sie lieber vergessen würde. Kann sie die Geister der Vergangenheit besiegen, ihre Angst Wurzeln zu schlagen überwinden und endlich das wahre Glück finden?
»Ich verschlinge Bella Osbornes Bücher!« Katie Fforde
»Absolut fantastisch. Lustig, herzergreifend, unterhaltsam und ich konnte es einfach nicht aus der Hand legen. Es ist der perfekte Sommerroman« Phillipa Ashley