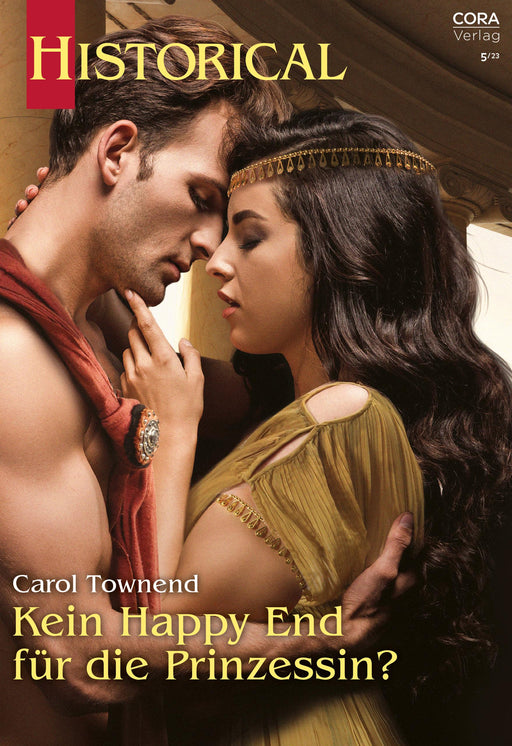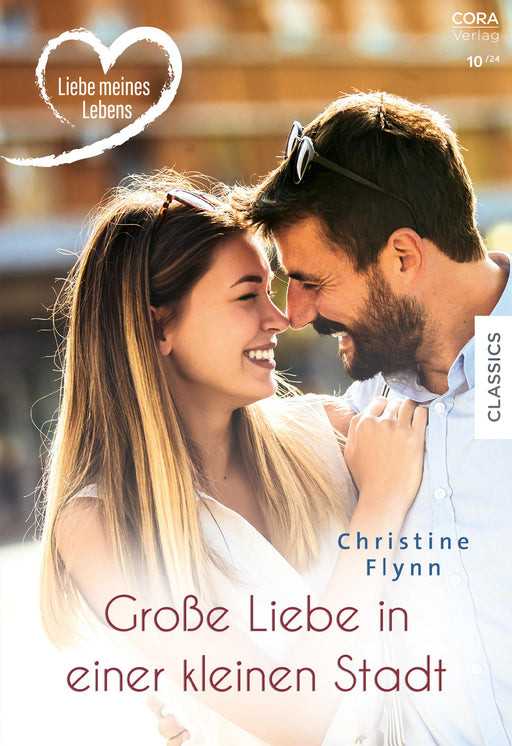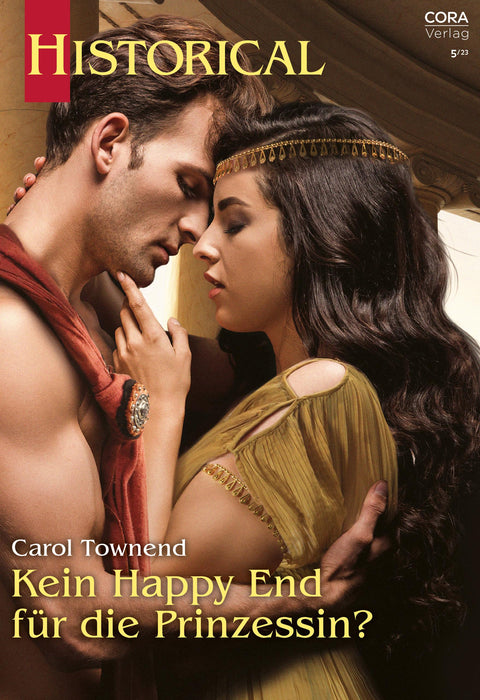
Kein Happy End für die Prinzessin?
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Frei sein! Nichts möchte Prinzessin Alba mehr, als ihrem tyrannischen Sultansvater zu entfliehen und die Palastmauern, hinter denen sie jahrelang gefangen war, hinter sich zu lassen. Als der ehrenwerte Conde Inigo der schönen Prinzessin zu Hilfe eilt, schöpft sie Hoffnung auf ein Leben in Freiheit – das sie nur zu gern mit dem spanischen Adligen verbringen möchte. Doch zu Albas Unglück ist Inigo mit einer anderen verlobt!