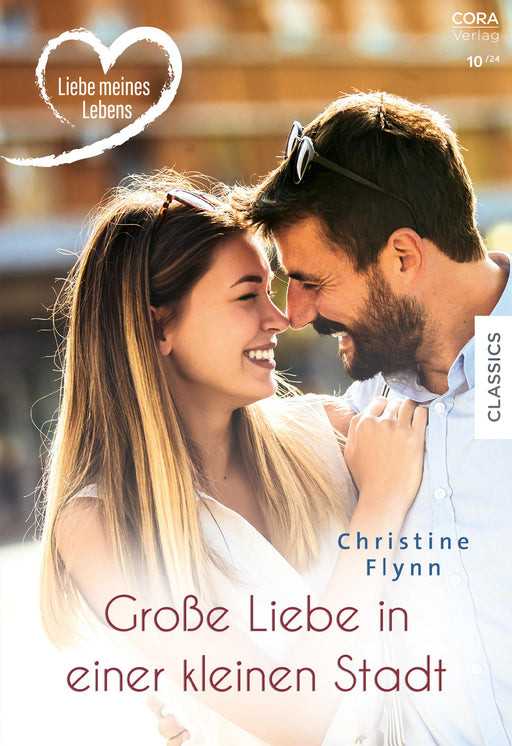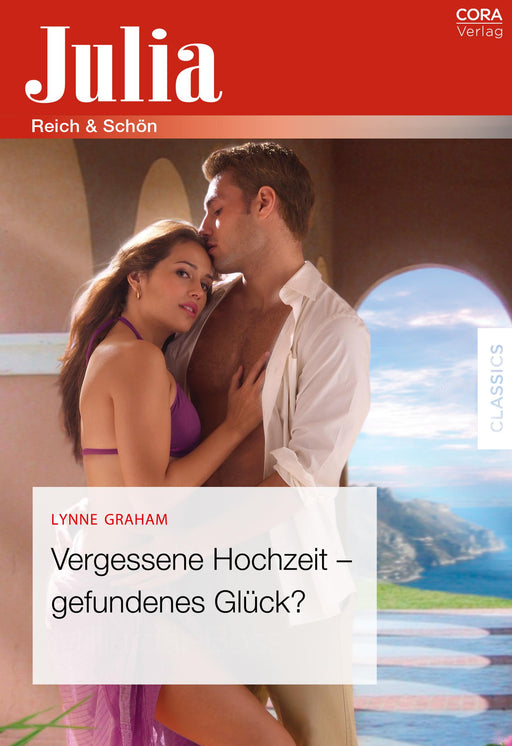Der schwarze Wolf von Claymore
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Schwarzer Wolf - so nennt man den englischen Heerführer Royce, Duke of Claymore. Er gilt als der erbittertste Gegner der Schotten. Und ausgerechnet eine Schottin ist Lady Jennifer, die seine Männer ihm als Gefangene übergeben. So begehrenswert sie auch ist, es wäre Verrat an England, würde Royce der Tochter seines ärgsten Feindes mit Gnade begegnen. Doch Jennifer, stolz und selbstbewusst, fasziniert ihn wie keine Frau zuvor und weckt seine Leidenschaft …Seltsam: Obwohl sie seine Gefangene ist fühlt sich Jennifer zu dem imponierenden Ritter hingezogen. Als sie jedoch fürchten muss, dass er sie dem englischen König ausliefern wird, flieht sie zurück zu ihrem Vater. Der aber will sie ins Kloster verbannen. Plötzlich hat Jennifer nur noch eine Hoffnung: Der Schwarze Wolf muss sie retten .