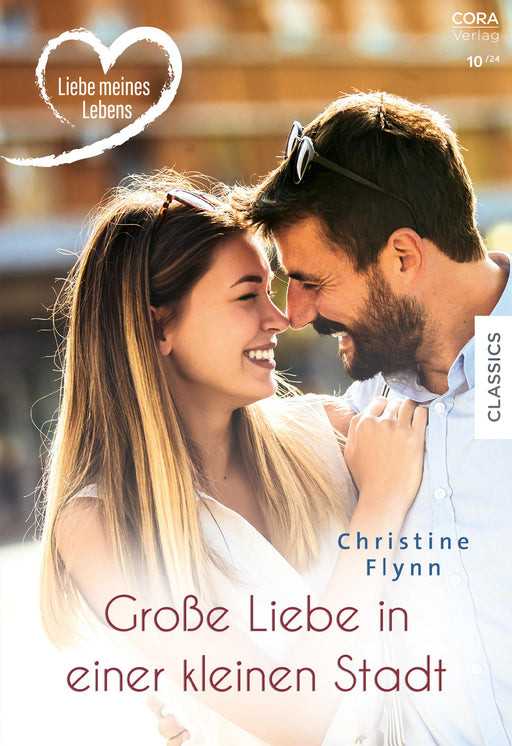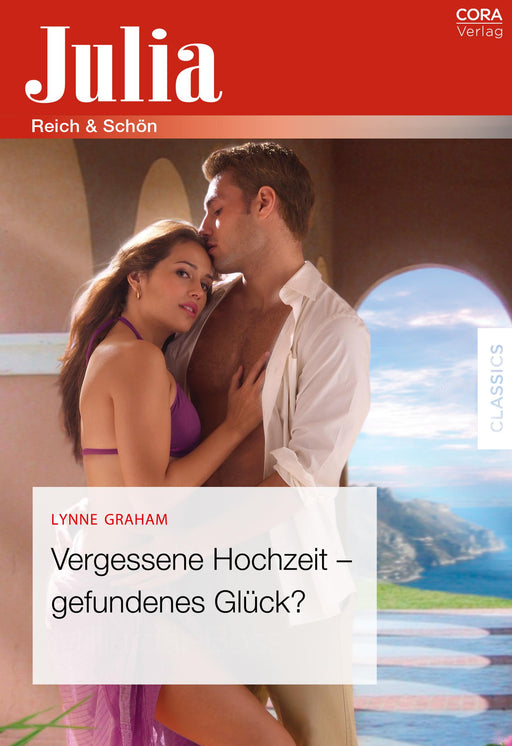DIE LADY IN WEISS
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
"Sie müssen mir helfen, Sir!", flüstert Caroline, Countess of Byfield. Doch statt ihr zu versprechen, nach ihrem entführten Mann zu suchen, macht Kapitän Jeremiah Sparhawk etwas anderes: Voller Leidenschaft zieht er Caroline an sich. Als trüge sie kein Ballkleid, sondern das weiße Kleid einer Braut - seiner Braut …