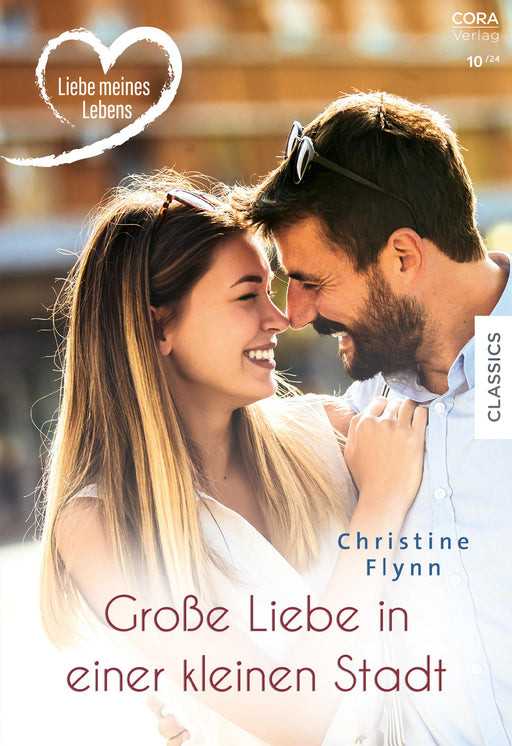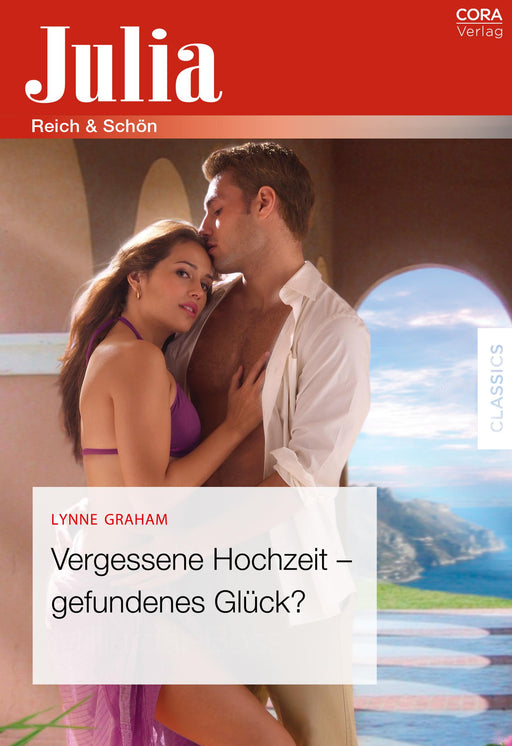Erfüllen Sie meinen Herzenswunsch, Mylord!
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
England, 1817: Dem Schicksal hat Viscount Darton es zu verdanken, dass er die betörende Charlotte Hobart kennenlernt. Sie ist nicht nur leidenschaftlich und wunderschön, sondern auch edelmütig. Als er erfährt, welch ehrbaren Herzenswunsch sie hegt, weiß er sofort: Diese Frau will er zur Seinen machen. Doch ein teuflischer Plan ihrer geldgierigen Verwandten droht seine Hoffnung auf die große Liebe zu zerstören