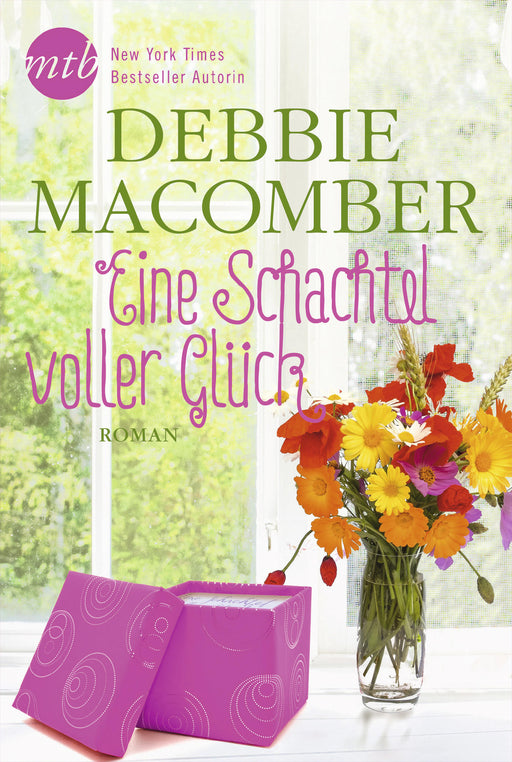Der Sommer der Wünsche
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Es ist Sommer in der Blossom Street, und in Lydias Wollladen »A Good Yarn« findet ein neuer Strickkurs statt. Abbie ist eine der Teilnehmerinnen und sie weiß, erst wenn sie die Liebe überwindet, die zerbrochen vor ihr liegt, kann sie nach vorn schauen und wieder glücklich werden. Wie beim Stricken muss sie erst mit dem Vergangenen abschließen, bevor sie neu beginnen kann. Doch die Nadel lässt sich mit jeder Masche leichter führen, bis schließlich der letzte Faden vernäht ist. Und Abbie spürt: Gemeinsam mit Freunden kann sie alles schaffen.
»Wenn es darum geht, einen ganz besonderen Ort und unvergessliche, integre Charaktere zu schaffen, kann niemand Debbie Macomber das Wasser reichen.« BookPage
»Debbie Macomber schafft es ohne Anstrengung, dass jedes Buch der Blossom-Street-Serie einzigartig und erfrischend ist.«
Library Journal