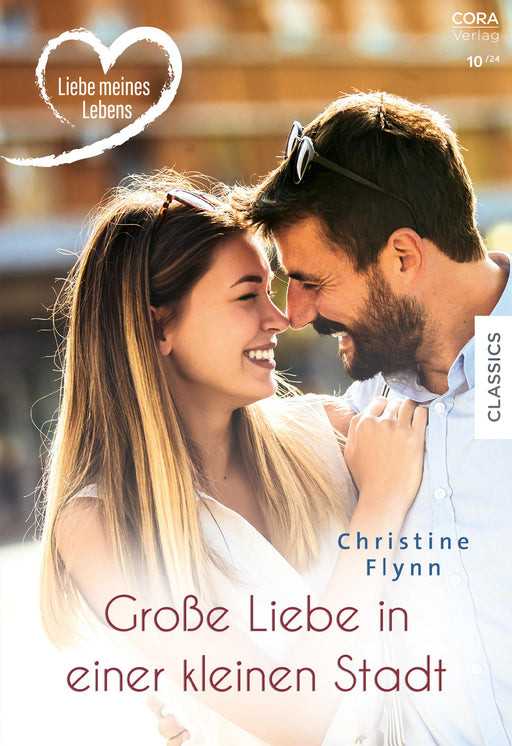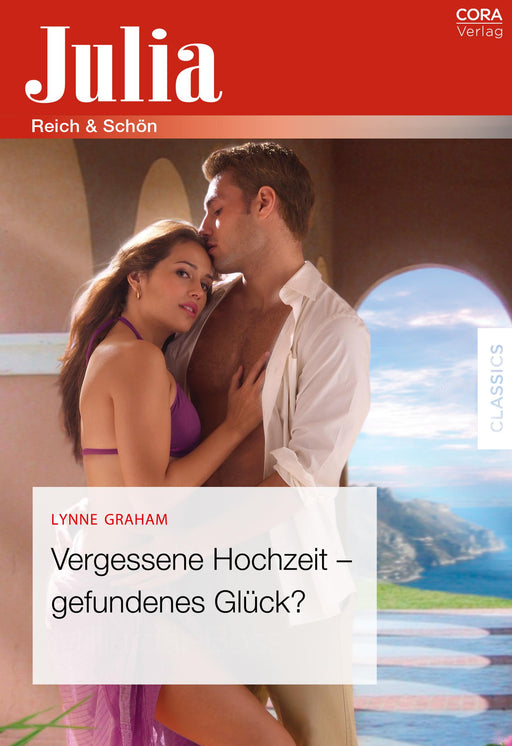Historical Saison Band 72
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
SÜNDIGE NACHT MIT DER KURTISANE von DIANE GASTON
Unvergesslich ist die sündige Liebesnacht, die Oliver, unehelicher Sohn eines Marquess, in Paris mit der schönen Cecilia verbracht hat. Wie groß ist seine Überraschung, als er sie plötzlich in seinem eleganten Gentlemen’s Club in London wiedersieht! Mit einem süßen Geheimnis, das sie nicht länger verleugnen kann …
DER UNVERGESSLICHE VISCOUNT BROMLEY von SOPHIA JAMES
Über sechs Jahre war Nicholas, Viscount Bromley, verschwunden. Keine Nacht ist vergangen, in der Lady Eleanor nicht sehnsüchtig an ihn gedacht, sich um ihn gesorgt hat! Jetzt ist er wieder in London, und Eleanor will Antworten. Warum schaut er sie an, als hätte es niemals die brennende Leidenschaft zwischen ihnen gegeben?