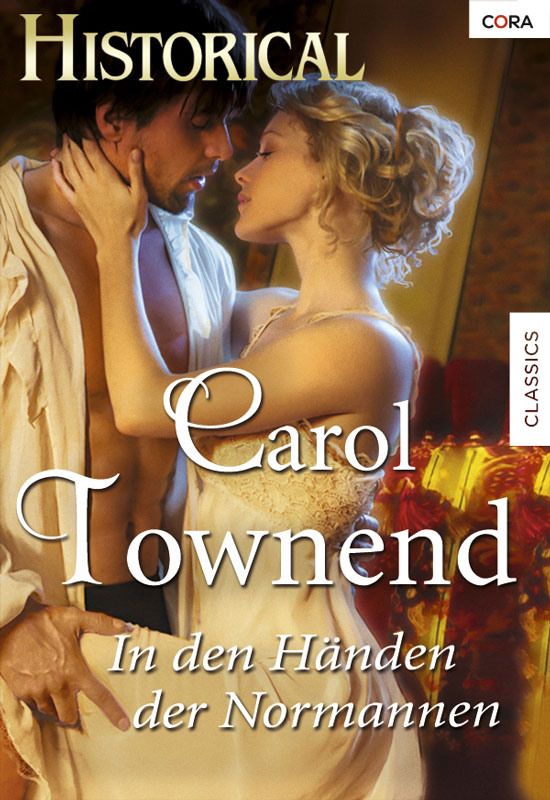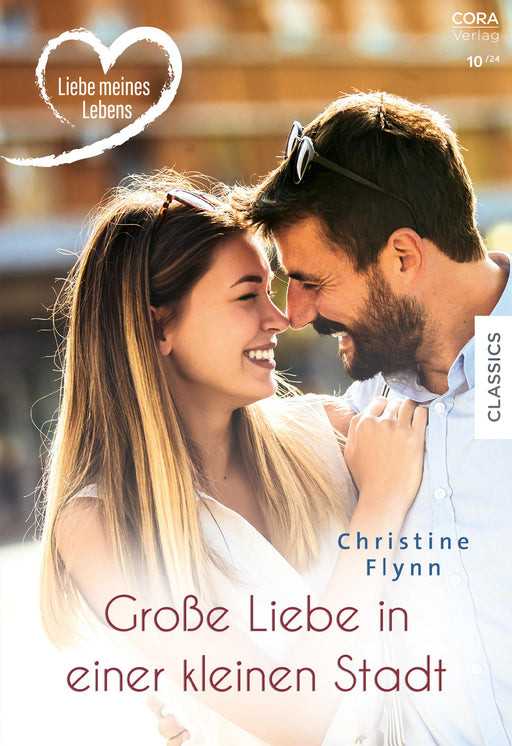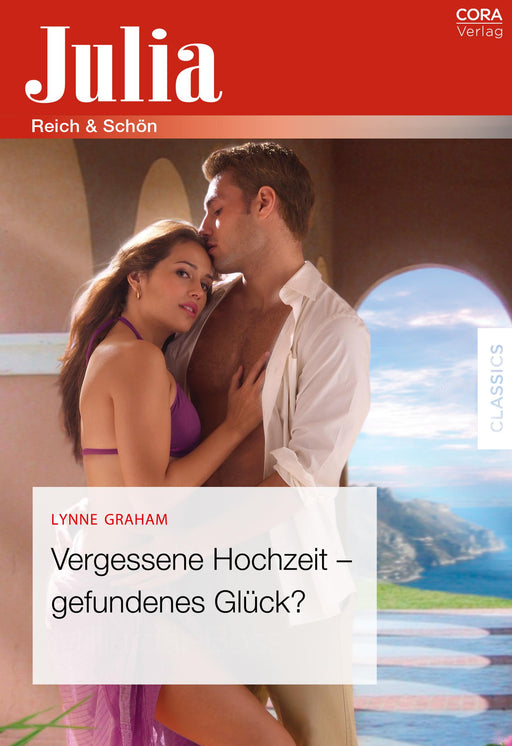IN DEN HÄNDEN DER NORMANNEN
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Wer ist ihr geheimnisvoller Retter? Nächtelang träumt die blutjunge Sächsin Judith von dem attraktiven Fremden, dank dessen Hilfe sie einen grausamen Überfall überlebt hat. Aber kaum sieht sie ihn wieder, könnte sie entsetzter nicht sein: Roland de Mandeville ist ein Normanne - ein Mann, den sie niemals lieben darf!