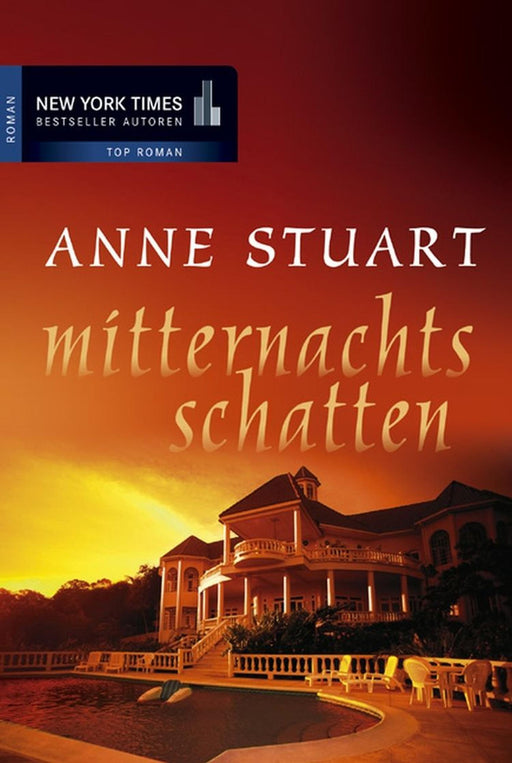Architektur des Grauens - zwei Thriller von Anne Stuart
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
MITTERNACHTSSCHATTEN
Ein geheimnisvoller Doppelselbstmord überschattet das Leben der jungen Architektin Jillian Meyer. Als jedoch die ganze Wahrheit ans Licht kommt, muss sie um ihr Leben fürchten. Mutig stellt sich die junge Architektin Jillian ihrem skrupellosen Vater Jackson Meyer entgegen. Er will so schnell wie möglich das Land verlassen, da ihm die Polizei auf den Fersen ist. Und sein Mitarbeiter Zacharias Coltrane soll ihm dabei helfen, Jillian und ihre Geschwister auszuschalten, damit sie ihm nicht in die Quere kommen können. Doch Coltrane verfolgt einen ganz anderen Plan. Er hat mit Jackson noch eine alte Rechnung zu begleichen. ...
DAS HAUS DER TOTEN MÄDCHEN
Ein packender Thriller und eine fesselnde Liebesgeschichte im grünen Vermont - doch die vermeintliche Idylle ist trügerisch: Einst wurden hier Mädchen grausam ermordet. Ein Mann wurde gefasst und für die Tat verurteilt. Jetzt ist er wieder frei. Doch ist Thomas Griffin überhaupt der Schuldige? Er kann sich nicht erinnern. Unter falschem Namen kehrt er zurück, um die Wahrheit aufzudecken und Licht in das Dunkel seiner Erinnerung zu bringen.