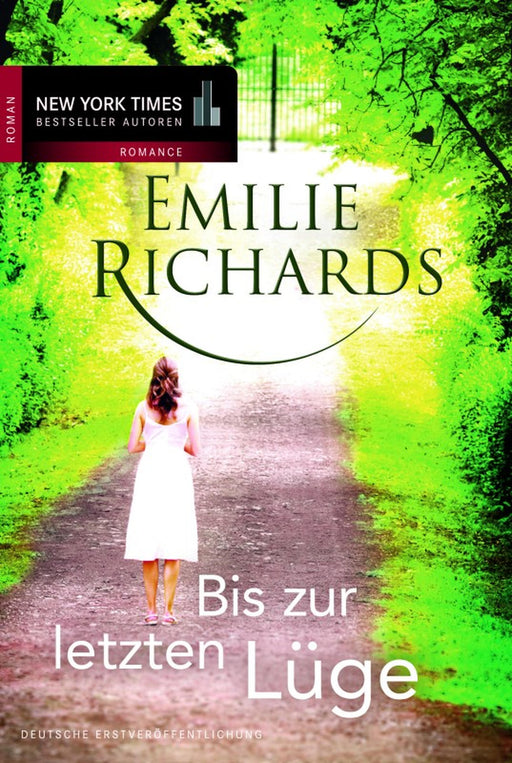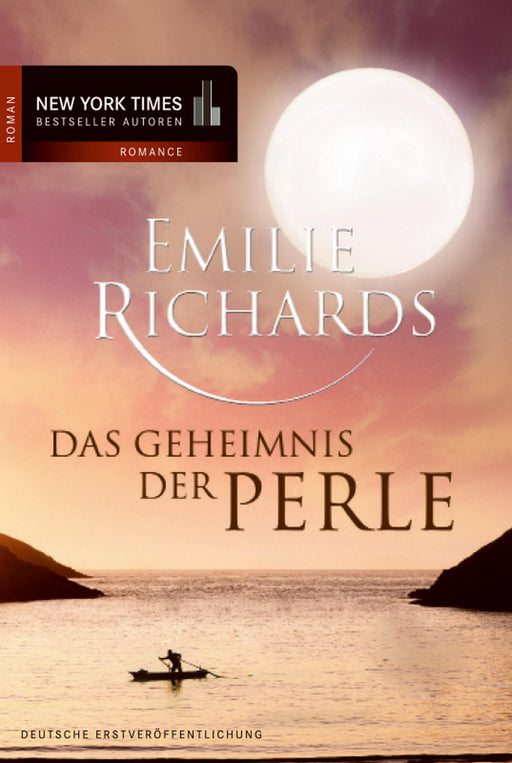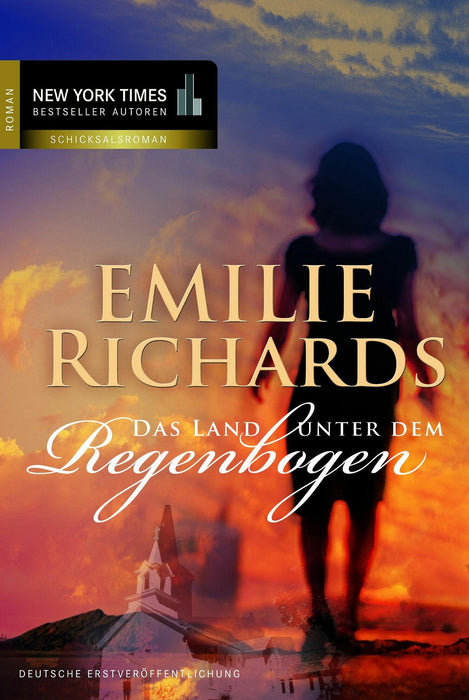
Das Land unter dem Regenbogen
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Reverend Sam Kinkade ist den Mächtigen ein Dorn im Auge. Unerschrocken prangert er Menschenrechtsverletzungen in Südamerika an und zahlt dafür einen hohen Preis: Er muss sein einflussreiches Amt in Atlanta, seine Karriere als Fernsehprediger aufgeben und wird in eine kleine Landgemeinde versetzt. Doch auch hier geht Sams einsamer Kampf gegen das Unrecht weiter. Bis er bei seinen Bemühungen für mexikanische Tagelöhner die attraktive Maria kennen lernt. Sie wird seine Mitstreiterin - und die Frau, mit der er sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen kann. Doch dann findet Sam heraus, dass Maria eine Lüge lebt. Angst ums nackte Überleben haben sie dazu gebracht, ihm ihre Herkunft und Flucht aus Guatemala zu verschweigen ...