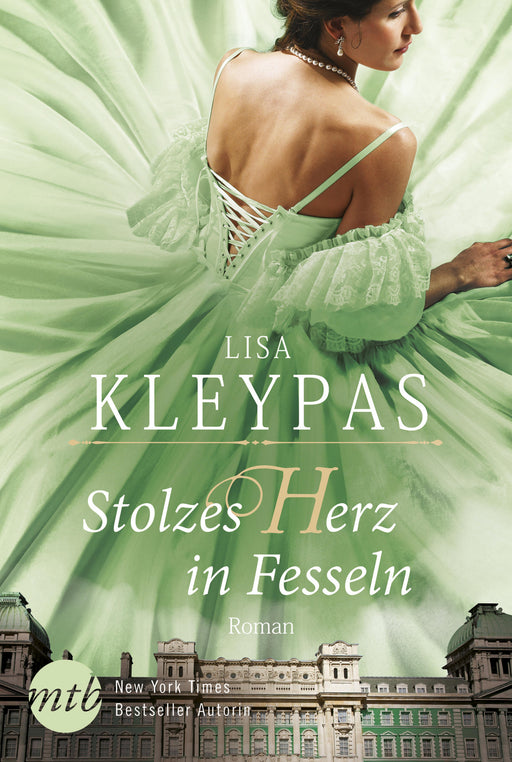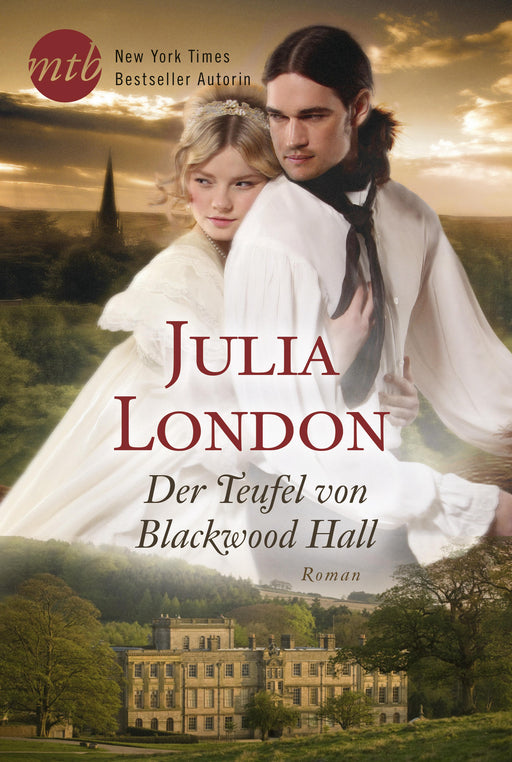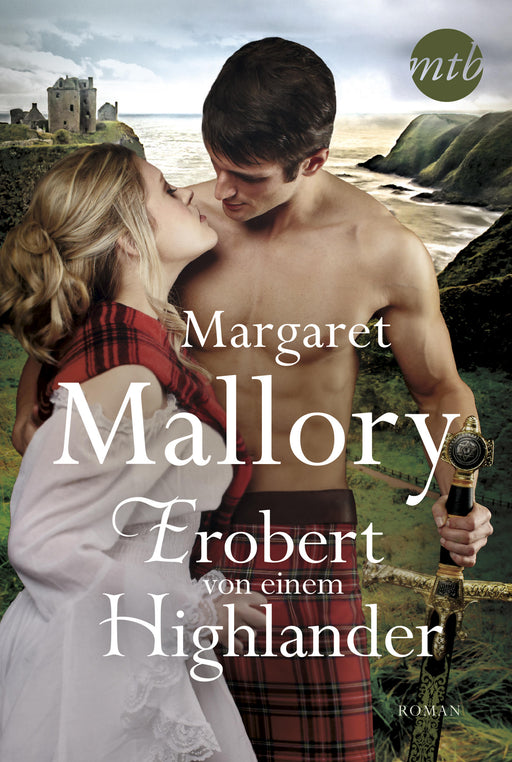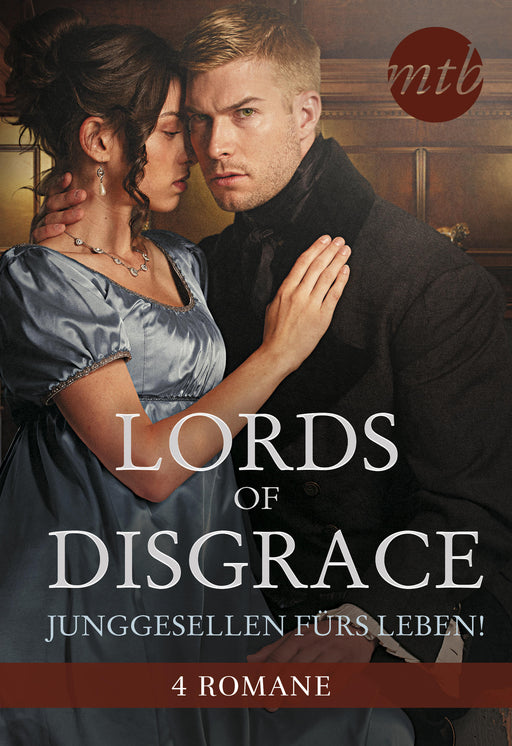Dem Himmel entgegen
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Als Ella einen Job als Pflegerin bei dem wortkargen Harris und seiner kleinen Tochter Marion annimmt, hofft sie, ihr eigenes Leben endgültig hinter sich lassen zu können. Zu schmerzhaft waren die Erfahrungen, die sie als Kinderkrankenschwester in der Notaufnahme machen musste. Doch auch in der wildromantischen Einsamkeit South Carolinas lässt ihre Vergangenheit sie nicht zur Ruhe kommen, denn sie spürt, dass sie Tochter und Vater schneller in ihr Herz schließt, als ihr lieb ist. Harris scheint nur seine Pflegestation für verletzte Greifvögel im Kopf zu haben - bis eines Tages Marions Mutter unerwartet wieder auftaucht ...