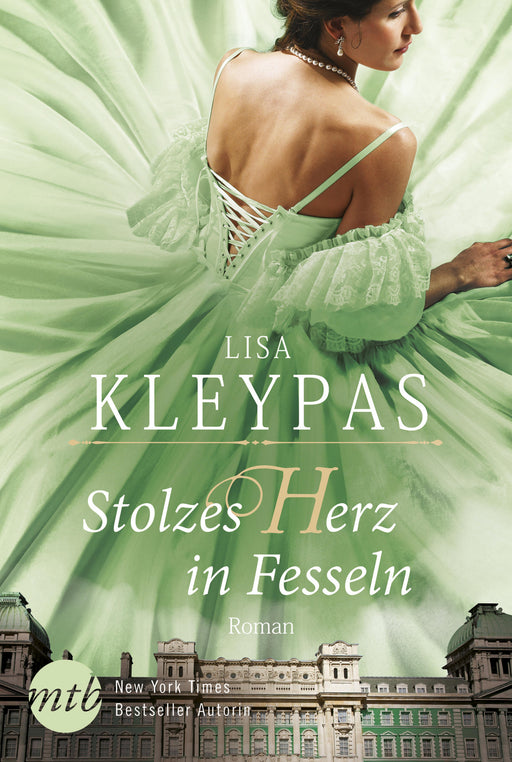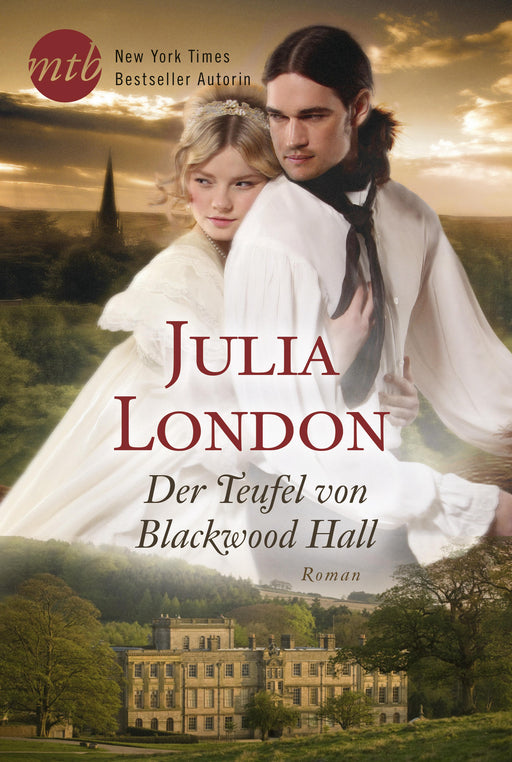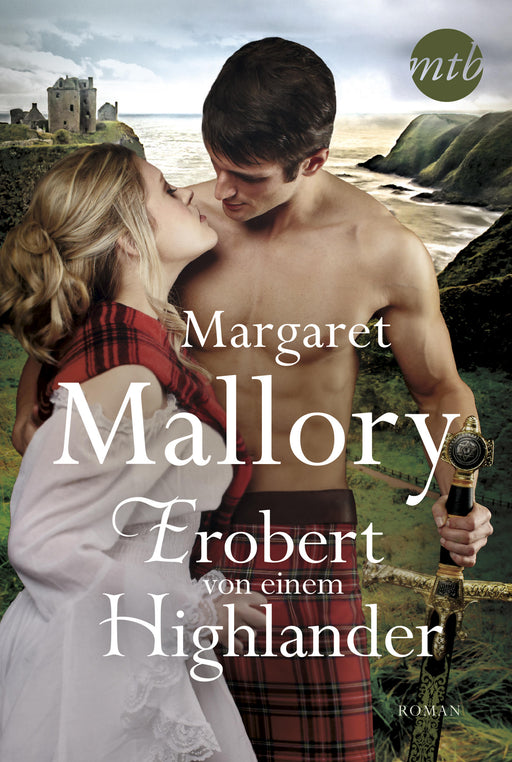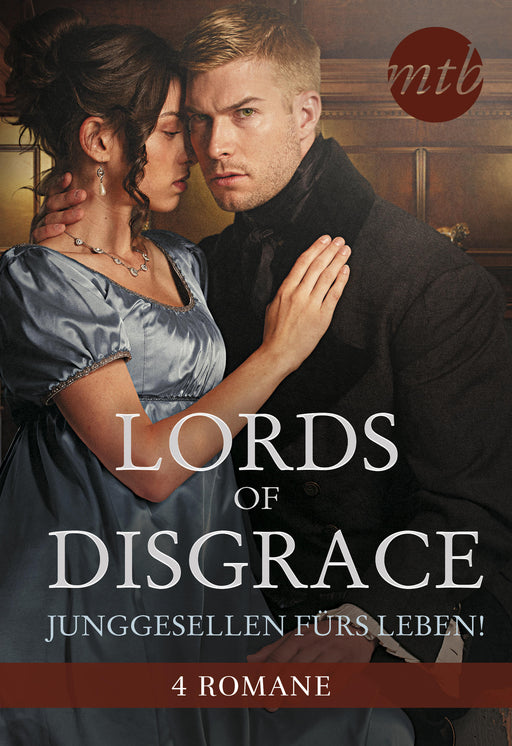Die Herzogin, ihre Zofe, der Stallbursche und ihr Liebhaber
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Herzogin Camille ist verzweifelt: Ihr grausamer Ehemann will sie umbringen, damit er sich eine junge, gefügige Frau suchen kann, die ihm endlich einen Erben schenkt. Statt tatenlos auf ihren Tod zu warten, entschließt Camille sich zur Flucht. Mit ihrem jungen Geliebten, dem Stallburschen Henri, und ihren ergebensten Dienern sucht sie Unterschlupf in Bordellen und gibt sich tabulosen körperlichen Freuden hin. Doch während sie noch lustvoll seufzt, sind ihnen die Männer des Herzogs bereits auf den Fersen …