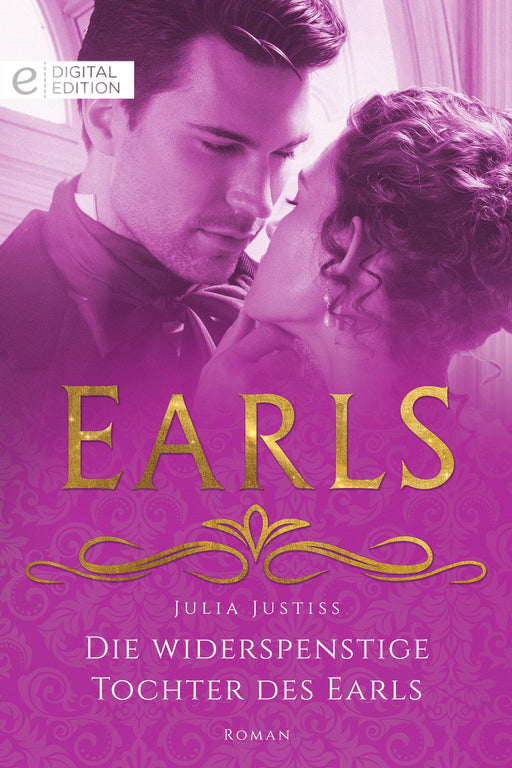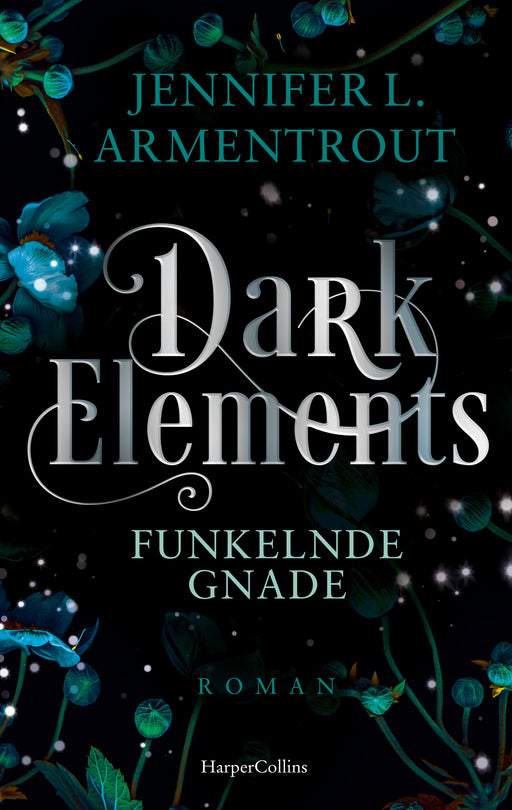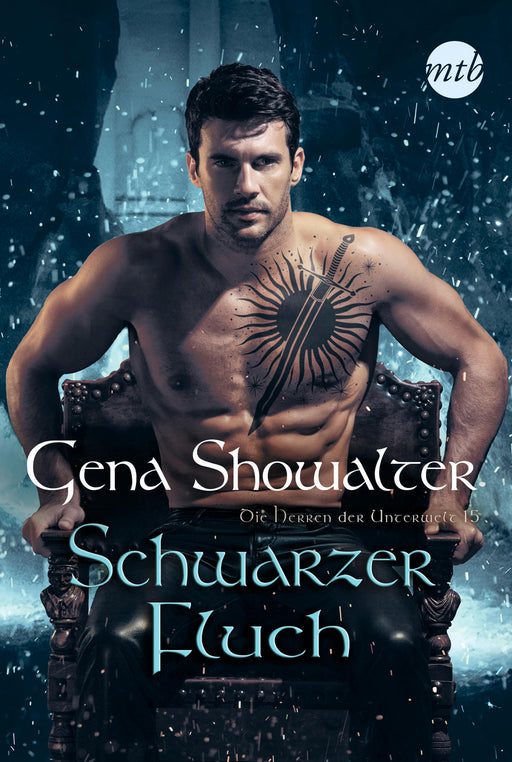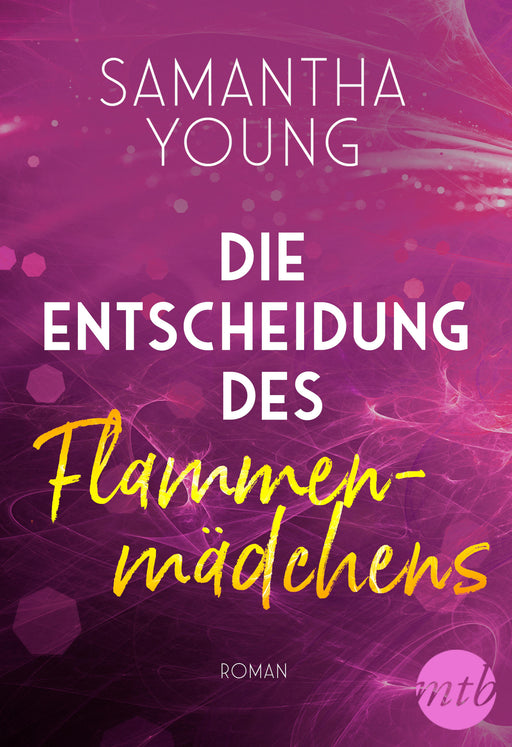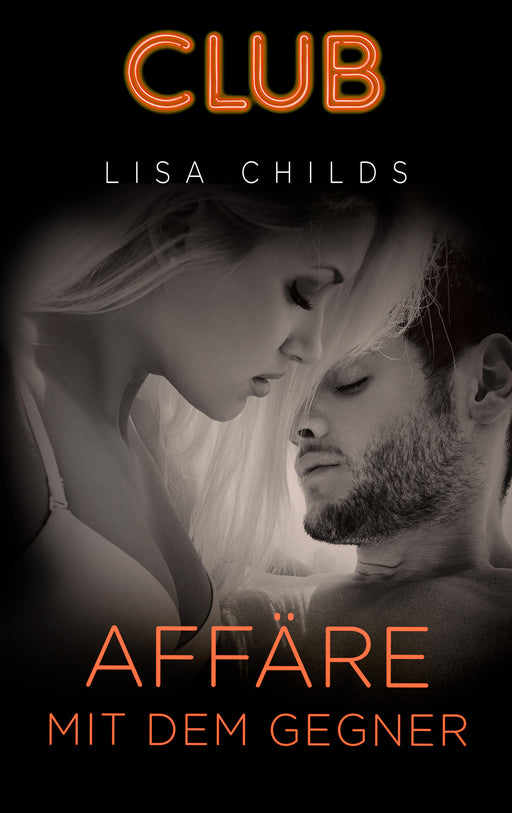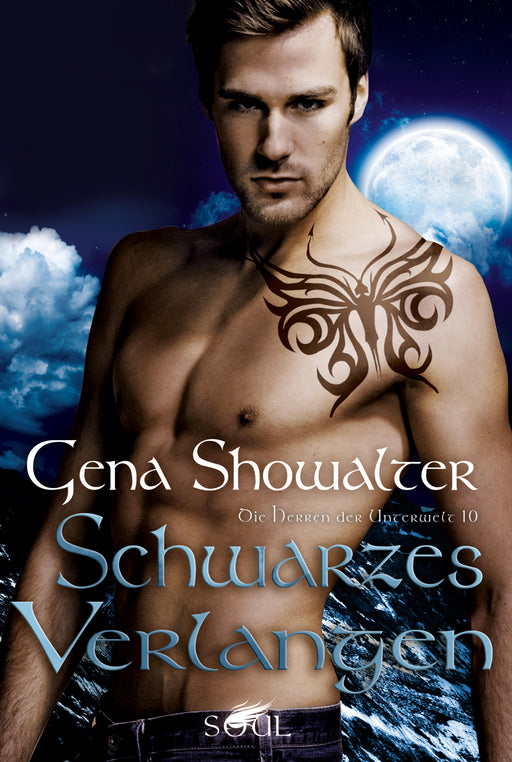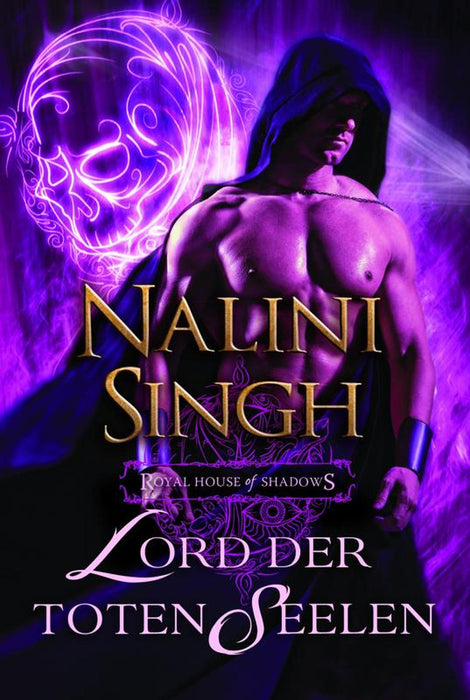
Lord der toten Seelen
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Die Erben des Schattenreichs: Das Finale der märchenhaft sexy Saga! Seite an Seite lebten Gestaltwandler, Werwölfe und Vampire im magischen Elden. Bis der grausame Blutzauberer das Königspaar stürzte. Erst wenn eins der Königskinder das Erbe antritt, kann Elden wieder aufblühen. Die Zeit der Entscheidung ist da!
Er ist ein Monster, das die Seelen gnadenlos in das Reich der Toten verbannt - sagt man. Aber die schöne Liliana weiß, was geschehen ist und dass hinter seiner schwarzen Rüstung ein Herz aus Gold schlummert. Nach nichts sehnt sie sich mehr als nach Freiheit und der Liebe des dunklen Ritters. Und wenn sie ihn von seinem Fluch befreit, wird er mit seinen Geschwistern um Elden kämpfen - gegen den grausamen Blutzauberer, Lilianas Vater. Die Entscheidung fällt um Mitternacht.