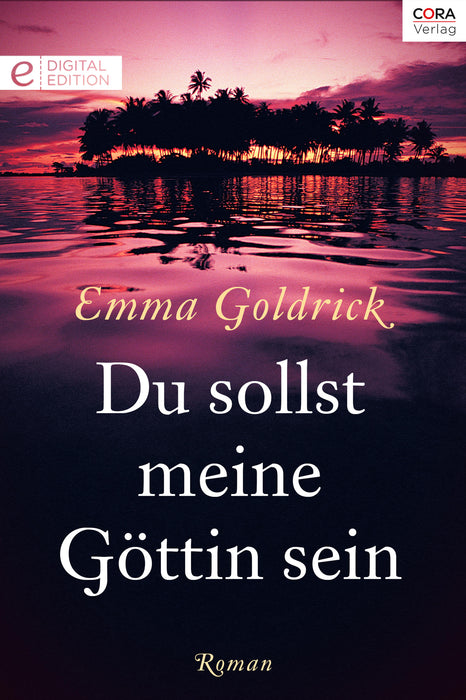
Du sollst meine Göttin sein
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Als Marie aus einer tiefen Ohnmacht erwacht, befindet sie sich auf der idyllischen Südseeinsel Te Tuahine. An ihrem Bett steht ein blendend aussehender Fremder, der behauptet, sie sei seine Frau. Obwohl Marie weiß, dass es nicht stimmt, spielt sie mit. Noch nie hat ein Mann sie so fasziniert...











