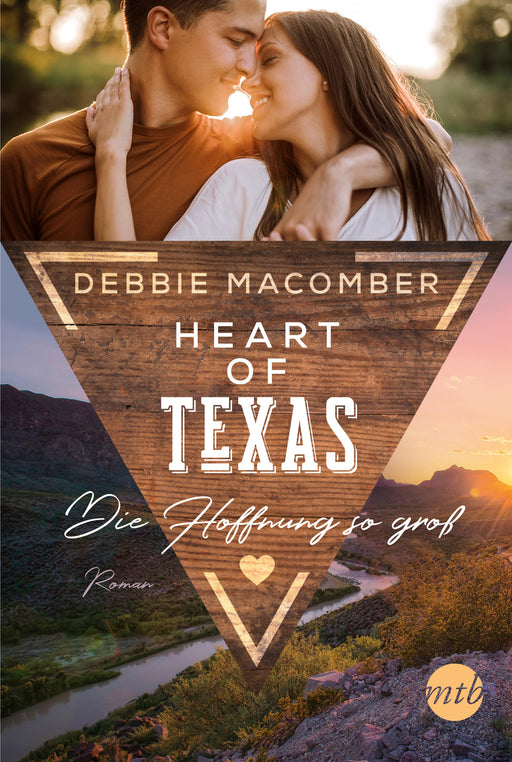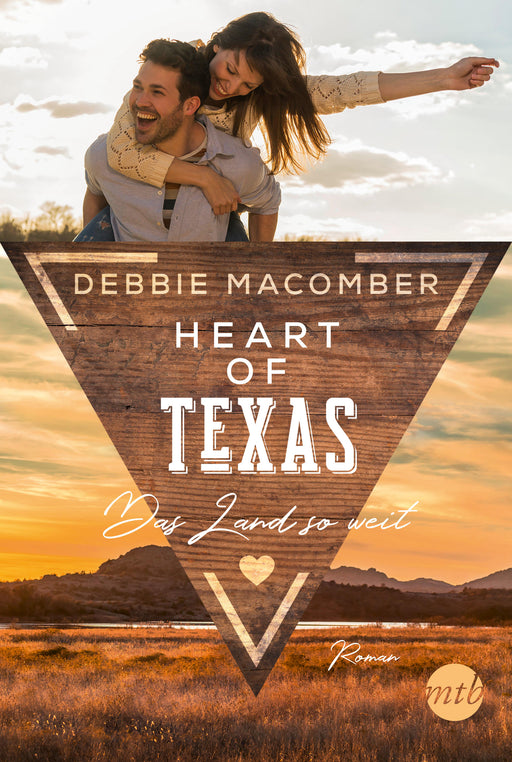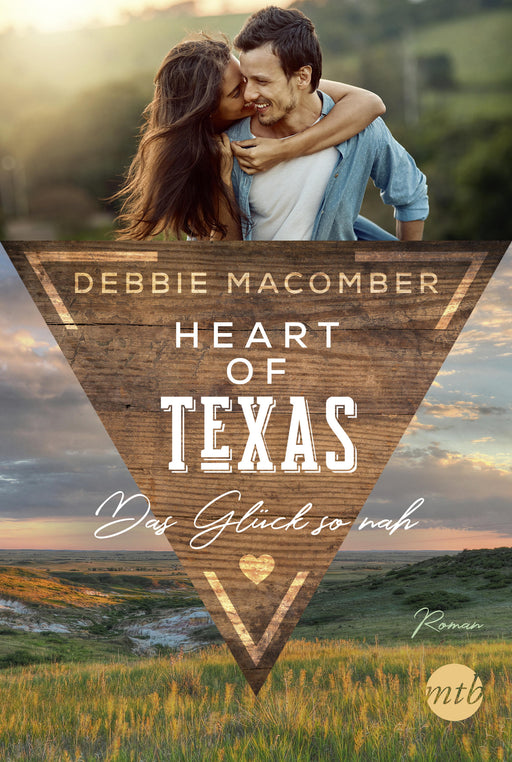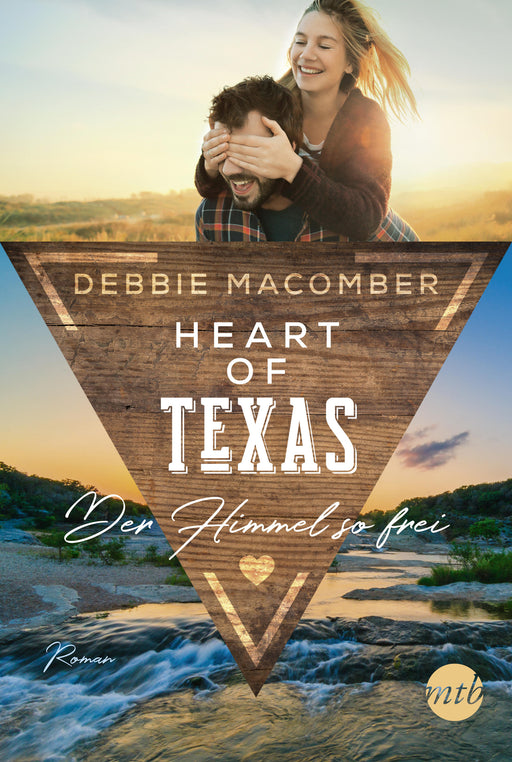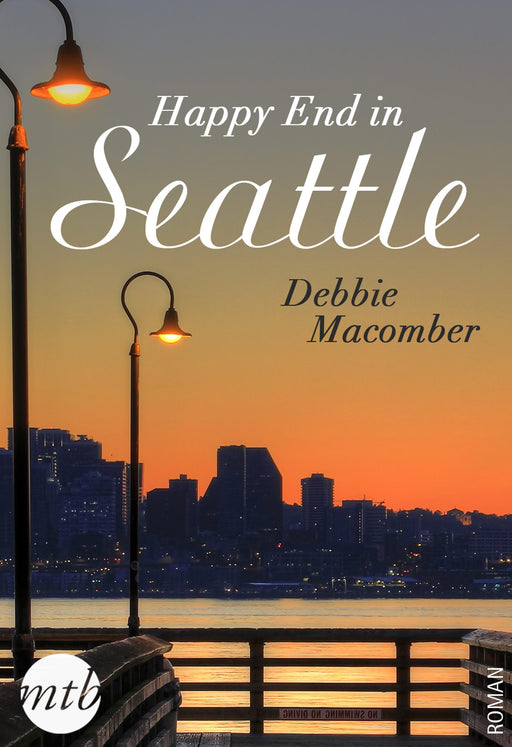Ein Sommer mit Debbie Macomber - 4 ganz unterschiedliche Geschichten
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
DER STERN VON YUCATAN
Gepäckkontrolle! Lorraine bleibt gelassen: Sie will nur ihren Vater besuchen, der hier in Mexiko lebt. Doch da findet die Polizei überraschend den "Stern von Yucatán" in ihrem Koffer. Wer hat ihr diesen uralten kostbaren Kultgegenstand ins Gepäck geschmuggelt? Lorraine muss fliehen, quer durch ein Land, das ihr fremd und gefährlich erscheint. Aber dabei gerät sie unversehens an einen faszinierenden Mann: den Abenteurer und Überlebenskünstler Jack Keller. Auf seinem Boot entkommen sie ihren Verfolgern - nicht aber ihren leidenschaftlichen Gefühlen füreinander, als leuchtend hell der Mond über dem Meer von Yucatán aufgeht ...
DER ERSTE BESTE MANN
Eine Legende rankt sich um das Hochzeitskleid, das Shelly zugeschickt wurde: Die Frau, die es erhält, heiratet den ersten Mann, den sie trifft. Prompt stolpert Shelly in die Arme des attraktiven Mark...
HAPPY END IN SEATTLE
Kinder sind schlauer als Erwachsene. Das denken zumindest Meagan und Kenny. Sie wollen eine neue Frau für ihren Vater Steve und finden: Hallie ist genau die Richtige. Doch für die selbständige Grafikerin, bald dreißig und entschieden auf Männersuche, wohnt das Glück nicht nebenan. Sie versucht es mit ihrem Steuerberater: Fehlanzeige. Und auch die Kandidaten der Partnervermittlung sind eine Enttäuschung. Steve tröstet sie über die verpatzten Affären hinweg, aber erst als eines Tages seine Ex vor der Tür steht, merkt Hallie, dass sie eifersüchtig ist.
IST DAS ALLES NUR EIN SPAß FÜR DICH?
Unvorstellbar! Susannah scheitert an einem Baby. Ihre kleine Nichte hört nicht auf zu schreien. Zum Glück eilt Susannah ihr Nachbar Tom zur Hilfe und die Karrierefrau erkennt, dass die Liebe in ihrem Leben ganz nah sein könnte …