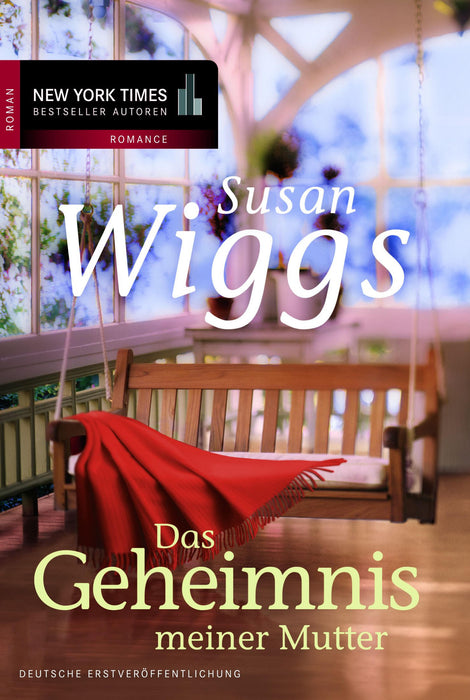
Das Geheimnis meiner Mutter
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Gibt es eine zweite Chance für die Liebe?
In der längsten Nacht des Jahres verliert Jenny Majesky ihren gesamten Besitz in einem alles zerstörenden Feuer. Nur wenige Habseligkeiten kann sie aus der Asche retten. Ihr alter Freund Rourke McKnight eilt ihr zu Hilfe - und weckt damit Gefühle, die es zwischen ihnen nicht geben darf. Jenny zieht sich alleine in die kleine Holzhütte am See zurück. Hier, in der Stille und Einsamkeit der winterlichen Landschaft will sie endlich das Buch über ihre Familie schreiben. Dabei entdeckt sie unter ihren Habseligkeiten einen Schatz, dessen Herkunft ihr völlig rätselhaft ist. Gemeinsam mit Rourke macht sie sie daran, das Geheimnis zu ergründen. Es betrifft ihre verschwundene Mutter, ihren neu entdeckten Vater und einen Mann, der nicht zögern würde, sie für immer zum Schweigen zu bringen.


 Tasse warmes Wasser
Tasse warmes Wasser Tassen Mehl
Tassen Mehl











