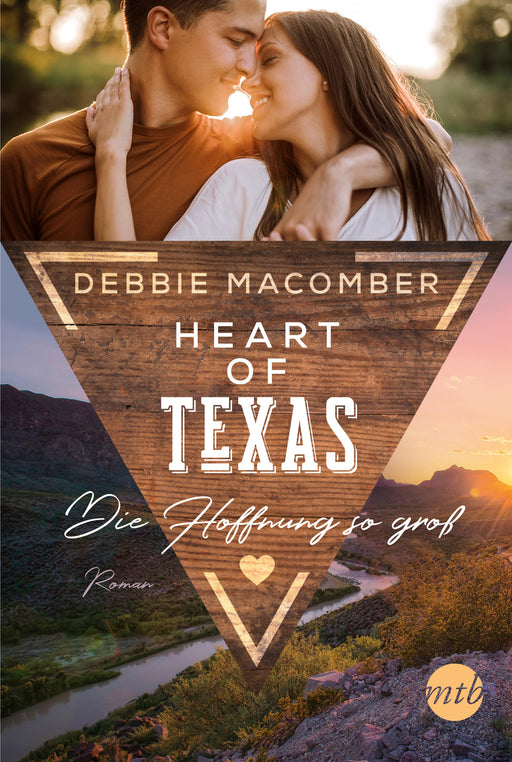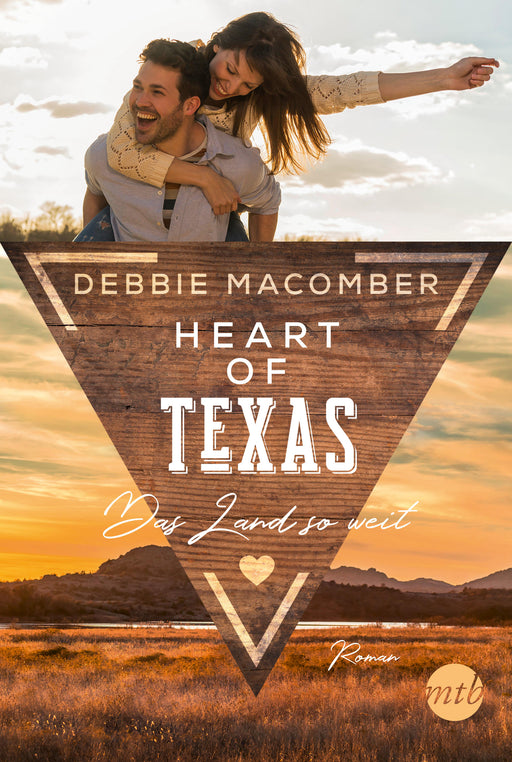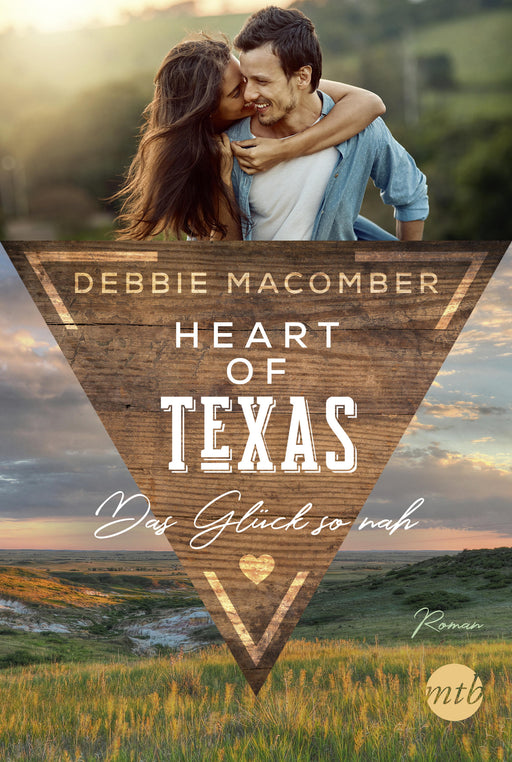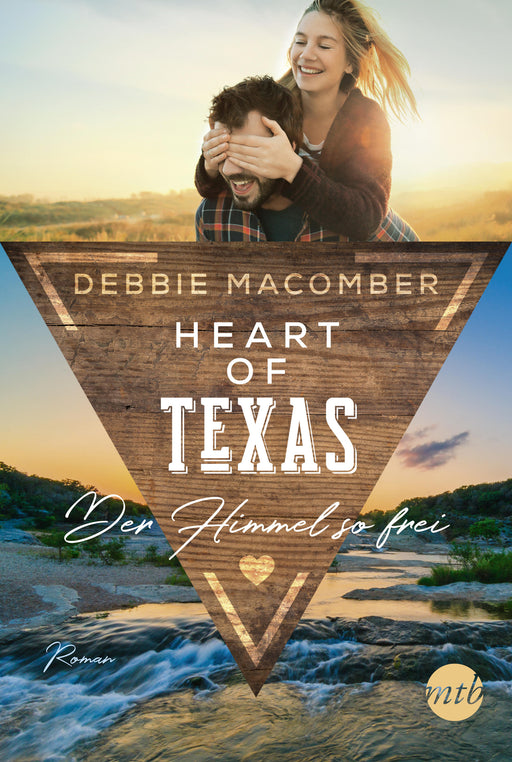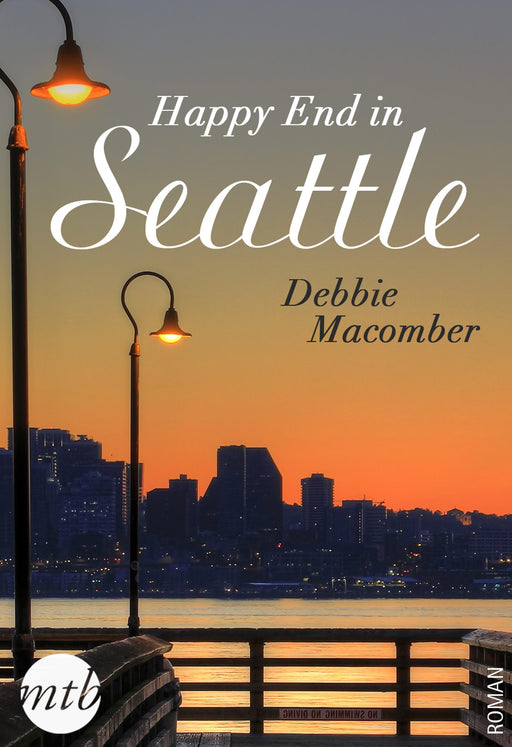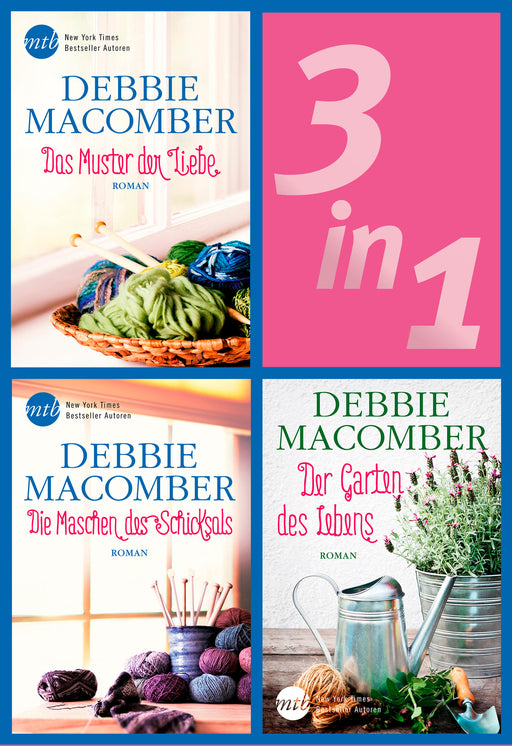Das Sommerhaus des Glücks
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Nahe der Küste von Washington liegt die kleine Insel Spruce Island. Hier, direkt am Strand, wo die Wellen glucksend gegen den kleinen Pier schlagen, befindet sich das malerische viktorianische Sommerhaus »Rainshadow Lodge«. Ein ganz besonderer Ort, an dem drei Frauen je einen Monat verbringen - einen Monat, der ihr Leben für immer verändern wird: Die geschiedene Catherine trifft auf ihre unvergessene Jugendliebe Michael. Die junge Witwe Beth und ihr Teenager-Sohn müssen sich das Sommerhaus mit einem charmanten Fremden teilen. Und die entspannte Rosie ist gezwungen, auf engstem Raum mit dem attraktiven Workaholic Mitch zusammenzuarbeiten.
»Drei der talentiertesten Liebesromanautorinnen überhaupt! »Das Sommerhaus des Glücks« entführt die Leser auf eine paradiesische Insel, wo Herzen zueinander finden und die Liebe regiert.«
Literary Times