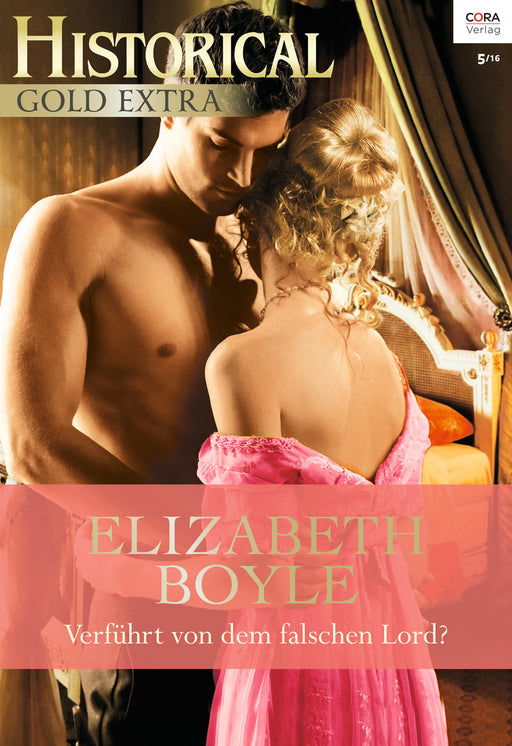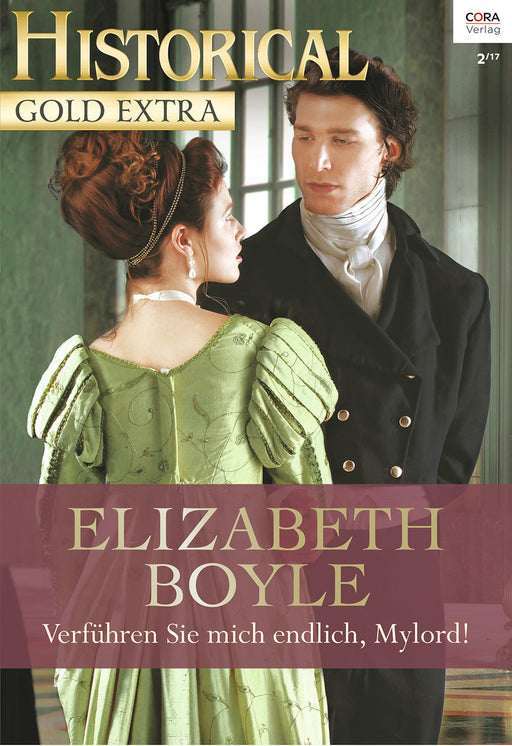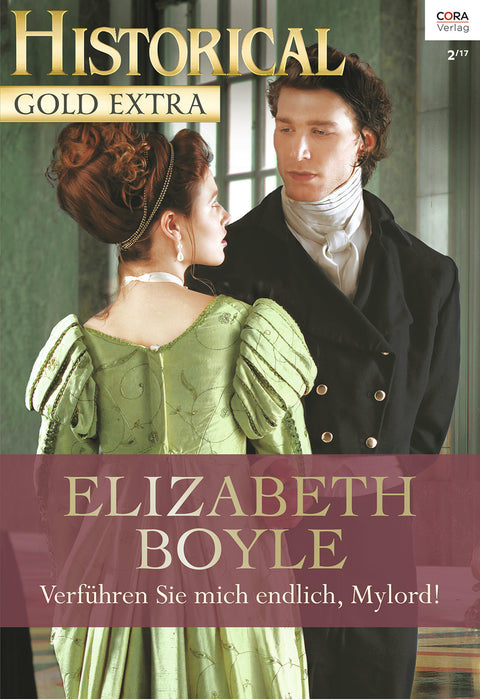
Verführen Sie mich endlich, Mylord!
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Seit Kindertagen hat Harriet nur ein Ziel: Sie will den Earl of Roxley heiraten. Jetzt ist es an der Zeit! Sie muss den umschwärmten Adeligen nur beim Maskenball davon überzeugen, dass aus dem Mädchen von einst eine begehrenswerte Frau geworden ist. Schneller als gedacht kann sie ihn zu einem Kuss verlocken. Deutlich spürt sie sein Verlangen - doch nur wenige leidenschaftliche Minuten sind ihnen vergönnt. Ob Roxley sie wohl bei ihrem nächsten Treffen verführen wird? Als Harriet den stolzen Earl wiedertrifft, ist sie erschüttert: Er ist plötzlich verlobt! Dabei sieht sie doch noch immer die Leidenschaft in seinen Augen - für sie …