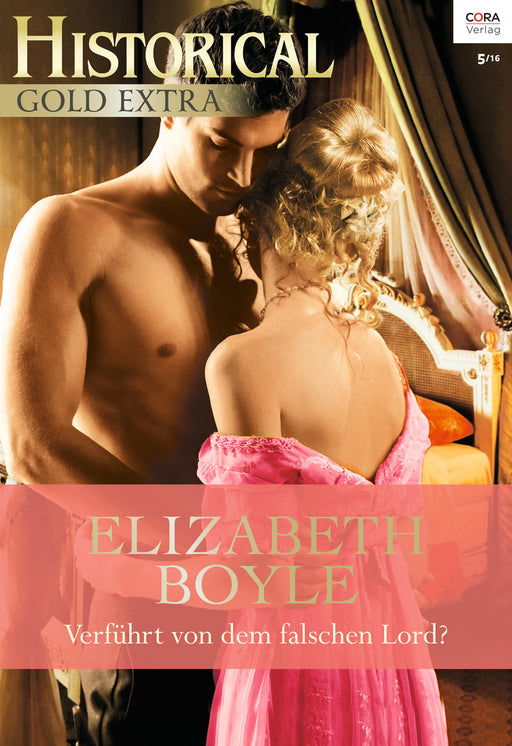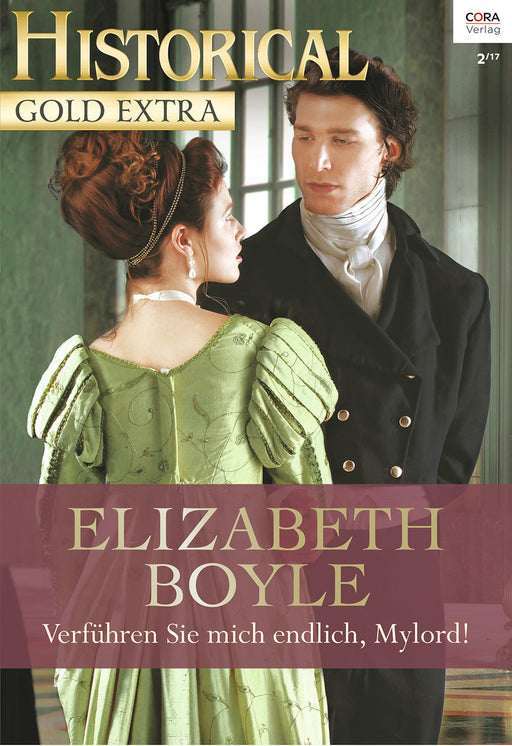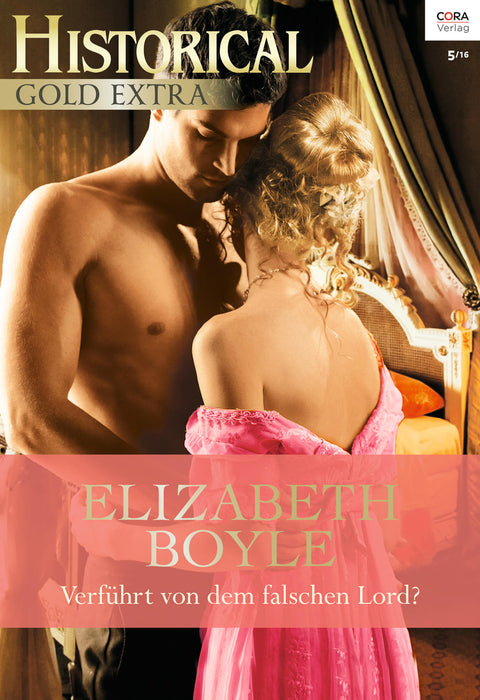
Verführt von dem falschen Lord?
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
"Tragen Sie Rot, damit ich Sie erkenne!" Daphnes Herz klopft zum Zerspringen, als sie die Worte liest. Seit sie auf die Heiratsanzeige eines Mr. Dishforth geantwortet hat, schreiben sie sich zunehmend zärtlich. Und auf dem heutigen Ball wird sie ihn endlich kennenlernen. Als ein attraktiver Fremder sie auffordert, ist Daphne sicher: Er ist ihr geheimnisvoller Briefeschreiber! Ein Märchen scheint wahr zu werden - bis Daphne schockiert den Namen ihres Tanzpartners erfährt: Henry Seldon! Seit Jahrhunderten tobt eine Fehde zwischen Daphnes Vorfahren und der skandalösen Seldon-Familie. Wo ist Mr. Dishforth, um sie vor dem zügellosen Lord zu retten?