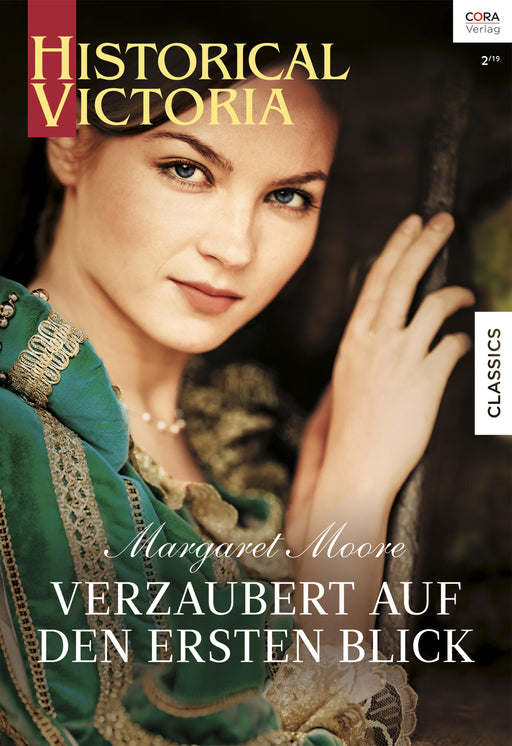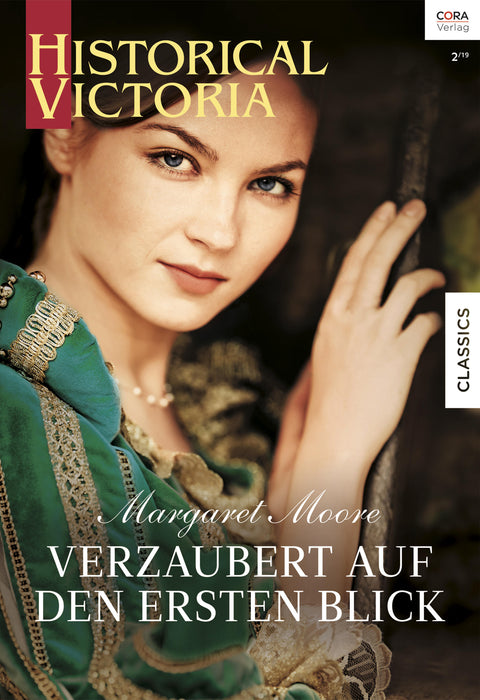
Verzaubert auf den ersten Blick
– oder –
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Ludgershall Castle, 1204: Mit dem Heiraten hat es die bildhübsche Adelaide d’Averette nicht eilig, lange genug hat sie die unglückliche Ehe ihrer Eltern erlebt. Ein Glück zu zweit war nie ihr Traum - bis sie Armand de Boisbaston begegnet. Nach dem ersten Blick in seine goldbraunen Augen ist Adelaide von dem jungen Lord mit dem unwiderstehlichen Lächeln verzaubert. Ihn weist sie nicht zurück - im Gegenteil! Als sie in Armands Armen liegt und seinen heiß ersehnten Kuss auf ihren Lippen spürt, versinkt die Welt um sie. Einen süßen Moment lang existiert nichts anderes mehr. So hört sie nicht die Stimmen, die von Verschwörung und Mord flüstern …